Ihr Warenkorb ist leer
Menü
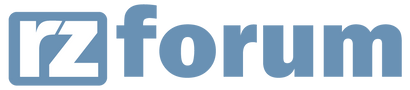
Aufwind für Solar- und Windenergie
2 min lesen.

Foto: Energieagentur Rheinland-Pfalz
Im Vorderhunsrück wird eines der größten Solarfelder in Rheinland-Pfalz gebaut
Entlang von Autobahnen und Bundesstraßen prägen sie zunehmend das Landschaftsbild: großflächige Solarparks. Auf ehemaligen Grün- oder Ackerlandflächen reihen sich heute Solarmodule aneinander, die sich der Sonne zuwenden und klimafreundlichen Strom erzeugen. Was vor wenigen Jahren noch als Zukunftsprojekt galt, ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil der deutschen Energiewende. Solarparks stehen dabei nicht nur für nachhaltige Energieerzeugung, sondern auch für neue Chancen in ländlichen Regionen – von zusätzlichen Einnahmequellen für Gemeinden bis hin zu einem Beitrag zur Versorgungssicherheit.
Eines der größten Solarfelder in Rheinland-Pfalz ist im Vorderhunsrück geplant. Der Solarpark soll auf einer Fläche von rund 40 Hektar errichtet werden und nach Fertigstellung eine Leistung von etwa 35 Megawatt erreichen. Damit könnte der Strombedarf von etwa 30.000 Menschen pro Jahr erzeugt werden. Das Leuchtturmprojekt leistet somit einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in der Region.
Der Solarpark sollte ursprünglich bereits 2022 in Betrieb gehen. Die Gemeinden Waldesch und Dieblich hatten beschlossen, gemeinsam mit dem Energieversorger evm einen Solarpark auf ihrer Gemarkung zu bauen. Die Mühlen der Bürokratie haben jedoch sehr lange gemahlen. „Wir planen jetzt die Eröffnung des Solarparks im ersten Halbjahr 2027“, sagt Pressesprecher Marcelo Peerenboom. Ganze acht Jahre wird das Projekt von der Planung bis zur Umsetzung nun dauern. Eine wahre Herausforderung für Investoren, die die Energiewende vorantreiben wollen.
Die evm hat zudem noch das Ziel, in den nächsten fünf Jahren Strom komplett aus erneuerbaren Energien anzubieten. „Ein ambitioniertes Ziel“, gibt Peerenboom zu. „Das wissen wir. Wir wurden auch schon gefragt, ob dies unser Ernst sei.“ Aktuell verbrauchen die evm-Kunden 550 Millionen Kilowattstunden. 90 Millionen kWh werden bereits regenerativ erzeugt. Um dieses Ziel zu erreichen laufen Projekte, die insgesamt 730 Megawatt Leistung hätten – 20 Prozent aus Solarkraft, 80 Prozent aus Windkraft. Und es sind weitere Projekte für 400 Megawatt geplant.
Die Überplanung hat seinen Grund: In Zukunft wird der Verbrauch an Strom durch E-Autos, Wärmepumpen oder Rechenzentren enorm steigen. Zur Nachhaltigkeit gehört deshalb auch die Nutzung von Stromspeichersystemen, um Schwankungen bei Wind- und Sonnenenergie auszugleichen. Je mehr gespeichert werden kann, desto autarken werden wir von fossilen Energien. Auf diesem Sektor liegt noch sehr viel Potenzial und die Branche boomt, kann aber nicht den Bedarf bedienen.
Die Leistungsfähigkeit moderner Windkraftanlagen hat sich enorm gesteigert. Doch nicht immer ist der Stromverbrauch identisch mit der erzeugten Energie. Und wenn die Windräder also zuviel Strom erzeugen, werden sie stillgelegt. Darüber wundern sich nicht selten Autofahrer, wenn sie auf der Autobahn an den „faulen“ Windrädern vorbeifahren. „Am häufigsten werden Sie stillstehende Windräder am Sonntag sehen“, weiß Peerenboom. „Der Grund ist, dass dann die Industrie nur sehr wenig produziert und spürbar weniger Strom verbraucht.“ Petra Dettmer


