Ihr Warenkorb ist leer
Menü
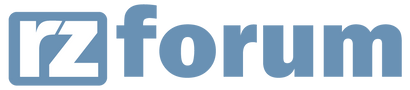
Daten steuern den Verkehr
2 min lesen.

Foto: cut – stock.adobe.com
Wie KI-Ampeln, Verbund-Apps und Sharing die Verkehrswende in Rheinland-Pfalz vorantreiben
Einleitung: Wenn Sensoren, Algorithmen und Echtzeitdaten das Tempo vorgeben, schrumpfen Wartezeiten an Knotenpunkten, Umstiege klappen zuverlässig – und Emissionen sinken. Rheinland-Pfalz zeigt in Städten und Landkreisen, wie digitale Werkzeuge Mobilität vernetzen: von lernenden Ampeln über Verbund-Apps bis zu Sharing-Diensten für die erste und letzte Meile.
Ampeln lernen Verkehr
Intelligente Steuerung beginnt an der Kreuzung. Verkehrsrechner verknüpfen Detektoren, Kameras und Fahrplandaten, optimieren Schaltzeiten und priorisieren Busse, Einsatzfahrzeuge oder Radachsen. In Pilotbereichen passen adaptive Programme die Grünphasen an aktuelle Ströme an – nicht nur zur Hauptverkehrszeit, sondern auch bei Events oder Störungen. Das Ergebnis: flüssiger Knoten, weniger Stop-and-Go, leiserer Verkehr. Für den Radverkehr kommen berührungslose Taster und virtuelle „Grüne Wellen“ in Tempo-30-Straßen hinzu; Busse erhalten Vorrang, damit Anschlüsse halten. In Hochschul- und Modellprojekten – etwa im Süden des Landes – erprobt KI die dynamische Steuerung ganzer Netze und lernt aus Mustern, um Staus schon vor dem Entstehen zu entzerren.
Alles in einer App
Der zweite Hebel sind Plattformen, die Wege in einem System denken. Verbund-Apps in Koblenz, Trier und der Rhein-Nahe-Region bündeln Zeitpläne, Störungsmeldungen, Echtzeit-Prognosen, Tarifauskunft und Handyticket. On-Demand-Verkehre lassen sich dort direkt buchen; Sie schließen Lücken im ländlichen Raum und binden Ortschaften an Taktknoten an. Entscheidend ist die Durchgängigkeit: Ein Ziel, ein Routenplaner – und am Ende ein digitales Ticket, das den Umstieg über Verbundgrenzen hinweg möglichst nahtlos ermöglicht. Offene Schnittstellen (z. B. zu Verspätungs- und Auslastungsdaten) erlauben es, Routenempfehlungen laufend zu aktualisieren und Wartezeiten zu minimieren.

Foto: sav_an_dreas – stock.adobe.com
Die letzte Meile teilen
Sharing-Dienste ergänzen Bus und Bahn. In Mainz/Wiesbaden stehen Leihräder, Pedelecs und E-Lastenräder per App bereit; in der Südpfalz und im Rhein-Neckar-Gebiet lassen sich Räder verbundübergreifend nutzen. Kommunale und genossenschaftliche Carsharing-Flotten erweitern das Angebot dort, wo Linienverkehre ausdünnen. Park-&-Ride-Plätze werden mit Belegsensoren und Park-Apps transparenter, Ladepunkte für E-Fahrzeuge dichter – wichtig für Lieferdienste, Carsharing und Pendler. Je besser diese Bausteine an Haltestellen, Bahnhöfen und Ortsmitten verzahnt sind, desto leichter gelingt der Umstieg auf klimafreundliche Wegeketten.
Was noch bremst – und was wirkt
Herausforderungen bleiben: Datensilos, unterschiedliche Buchungs- und Tariflogiken, Lücken beim Mobilfunk, Akzeptanzfragen im ländlichen Raum. Auch die Finanzierung intelligenter Infrastruktur muss dauerhaft gesichert werden. Zugleich zeigen Praxistests, dass adaptive Schaltungen Wartezeiten messbar senken, Buspünktlichkeit verbessern und Emissionen reduzieren können – vorausgesetzt, Kommunen priorisieren den Umweltverbund an Knotenpunkten konsequent.
Ausblick
Damit die Effekte in die Breite kommen, braucht es drei Dinge: erstes landesweit kompatible, offene Daten- und Buchungsschnittstellen; zweitens eine klare Priorität für Bus, Bahn und Rad in der Signalsteuerung; Drittens regionale Allianzen, die Sharing, On-Demand-Verkehre und Parkinformationen in die Verbund-Apps integrieren. Wo diese Bausteine zusammenspielen, wird nachhaltige Mobilität zur naheliegenden Option – in den Städten ebenso wie zwischen Hunsrück, Eifel und Pfalz. Rot


