Ihr Warenkorb ist leer
Menü
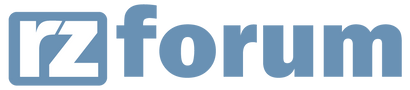
Grüner Wasserstoff: Chance für Rheinland-Pfalz
2 min lesen.

Foto: Mediaparts – stock.adobe.com
Wie Industrie, Forschung und Politik den Hochlauf in Rheinland-Pfalz organisieren
In Ludwigshafen läuft seit März 2025 ein 54-MW-PEM-Elektrolyseur der BASF. Die Anlage kann bis zu 8.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr bereitgestellt und schrittweise fossilen H₂ im Chemieverbund ersetzen. Parallelanlage Mainz ein lokales H₂-Initialnetz mit Pipeline und Abnehmern in der Industrie. Solche Projekte zeigen, wie Rheinland-Pfalz den Markthochlauf strukturiert angeht.
Projekte mit Signalwirkung
In Mainz entsteht ein Startnetz in Neustadt/Mombach: Eine rund 2,6 Kilometer lange Leitung soll Standorte entlang der Rheinallee bis zu Schott anbinden; Perspektivisch ist eine Betankung für Nutzfahrzeuge vorgesehen. Das Konzept fußt auf Vorarbeiten aus dem HyExpert-Programm und den Betriebserfahrungen des Energieparks Mainz, der seit 2015 dynamische Elektrolyse mit erneuerbarem Strom demonstriert (Stand: Juni–August 2025).
Netz und Potenzialräume
Damit Erzeugung und Nachfrage zusammenfinden, wird das Wasserstoff-Kernnetz entscheidend: Die Bundesnetzagentur hat am 22. Oktober 2024 ein 9.040-km-Rückgrat bis 2032 genehmigt – überwiegend durch Umstellung bestehender Gasleitungen. Für Standorte wie Ludwigshafen oder den Raum Mainz erhöht die gesicherte Anbindung Planungssicherheit für Investitionen.
Bundesnetzagentur
Rheinland-Pfalz hat Potenzialräume für die Erzeugung identifiziert: Mayen-Koblenz/Westerwald, Mainz/Alzey-Worms und die Vorderpfalz. Kriterien sind erneuerbarer Strom in der Nähe, Netzanbindung, Flächen und industrielle Nachfrage. Die Bündelung in Clustern Insellösungen und beschleunigte Genehmigung und Anschluss (Studie, Stand: Oktober 2024).
Wofür Wasserstoff sinnvoll ist
Wasserstoff bietet dort Vorteile, wo Elektrifizierung an Grenzen stößt: in Teilen der Chemie (zB Grundstoffe), bei Hochtemperatur-Prozessen sowie als saisonaler Speicher und Brennstoff für flexible Kraftwerke. In Mobilität und Wärme gilt: Erst Effizienz und Elektrifizierung prüfen, dann H₂ einsetzen, wenn Infrastruktur und Betriebsprofile passen.

Foto: brudertack69 – stock.adobe.com
Herausforderungen, die jetzt zählen
Kosten und Verfügbarkeit erneuerbarer Ströme bestimmen die Wirtschaftlichkeit. Für Projekte sind schlanke Verfahren nach Immissions-, Wasser- und Baurecht nötig, dazu klare Regeln für Netzzugang, Druckstufen und Qualität. Tragfähig wird der Betrieb über langfristige Abnahmeverträge (PPA), standardisierte Herkunftsnachweise und zuverlässige Anbindung an das Kernnetz. Kommunen und Betreiber müssen zudem Wasserbedarf, Sicherheitszonen und Flächen klären.
Der Hochlauf gelingt, wenn drei Ebenen ineinandergreifen: Industrie mit klaren Abnahmeprofilen, Forschung mit Transfer in Genehmigung und Betrieb, Politik mit Netzanbindung und verlässlichen Verfahren. Mit dem BASF-Elektrolyseur, dem Mainzer Initialnetz und definierten Potenzialräumen zeigt Rheinland-Pfalz, wie aus Strategie belastbare Infrastruktur wird (Stand: September 2025). Rot
Kurz erklärt
Grüner Wasserstoff ist per Elektrolyse mit Grünstrom erzeugter Wasserstoff. Er eignet sich für schwer elektrifizierbare Industrieprozesse, als Langzeitspeicher und für flexible Kraftwerke. Vorteil: Keine fossilen CO₂-Emissionen entlang der Erzeugung. Hürden: hoher Strombedarf, Kosten und Netzinfrastruktur. Abgrenzung: grau (fossil), blau (mit CO₂-Speicherung), türkis (Pyrolyse).


