Ihr Warenkorb ist leer
Menü
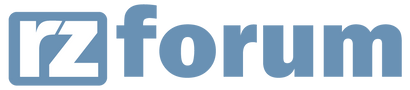
Wasserstoff im Rhein-Westerwald: Chancen, Grenzen und Ernüchterung
2 min lesen.

Foto: Deemerwha studio – stock.adobe.com
Wenn es darum geht, fossile Energieträger zu ersetzten, taucht immer wieder auch das Stichwort Wasserstoff auf. Das Transformationsnetzwerk Altenkirchen hat sich die Aufgabe gestellt, Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff in der Region Rhein-Westerwald möglichst konkret zu benennen – und mit Unterstützung der Transferstelle Bingen und der Hyfuels GmbH aus Siegen eine Studie für die Region erstellt, die auf über 83 Seiten zu gemischten Resultaten kommt. Ziel war es, mögliche Standorte, Anwendungen und wirtschaftliche Effekte auszuloten. Auf den ersten Blick zeigen die Ergebnisse durchaus Potenzial – doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich in Details auch Hürden.
Eine Vorstudie bezüglich der Wasserstoff-Potentiale in der Region war noch sehr optimistisch ausgefallen – ein zentraler Standort, an dem Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff gebündelt werden, schien realistisch. Erste Ideen reichten vom Einsatz von Elektrolyseanlagen über Abnahme durch lokale Stadtwerke bis hin zu möglichen Tankstellen für den Schwerlastverkehr. Hier brachte die erweiterte Studie Ernüchterung: Für ein solches Projekt gibt es keine geeigneten Flächen, die verfügbar wären und die geeigneten Standortbedingungen bieten.
„Wir sind alle mit viel Euphorie gestartet, mussten am Ende aber feststellen: So einfach geht es nicht“, berichtet Andreas Utsch vom Transformationsnetzwerk Altenkirchen. Die Hindernisse sind vielfältig: Abstandsregeln für Windräder, fehlende direkte Anschlussmöglichkeiten für Tankstellen, hohe Kosten für Netzausbau und Infrastruktur. Hinzu kommt die Frage der Finanzierung – die Summen, die ein regionales Wasserstoffzentrum verschlingen würde, sind für Kommunen und mittelständische Unternehmen in der aktuellen Situation nicht zu stemmen.
Für eine gelungene Transformation wäre auch die Mitarbeit der ansässigen Unternehmen wichtig. Die bisherigen Erfahrungen des Transferzentrums zeigen, dass nicht alle Firmen gleich gut eingebunden werden können. Große Unternehmen in der Region verfügen über eigene Forschungsabteilungen und Ressourcen, kleinere Betriebe dagegen kämpfen oft mit dem Tagesgeschäft und haben weder Zeit noch Personal, um sich intensiv mit der Energiewende zu beschäftigen. „Am Ende sind es häufig die gleichen Akteure, die aktiv mitmachen“, heißt es aus den Reihen der Projektpartner. Das Engagement und auch das Interesse sei zwar grundsätzlich vorhanden, aber insgesamt noch zu wenig breit aufgestellt.
Ein Umschwenken auf Wasserstoff bringt technische Veränderungen mit sich – die Unternehmen müssen schulen. Hier zeigen die Untersuchungen eine wachsende Bereitschaft zur Vernetzung: In Arbeitskreisen und Netzwerkformaten entstehen Kooperationen, die es so vorher nicht gab. So vermitteln Ausbildungsbetriebe Inhalte gemeinsam – Zusammenarbeit erleichtert die Transformation.
Dennoch bleibt die Bilanz zurückhaltend. Das Fazit der Beteiligten: Wasserstoff wird eine Rolle spielen, aber nicht in Form eines „großen Wurfs“. Stattdessen ist mit lokalen, dezentralen Lösungen zu rechnen, die jeweils an die regionalen Bedürfnisse angepasst sind. Gerade im Bereich Mobilität wird deutlich, dass eine „Einheitslösung“ unrealistisch ist.
Die Experten sehen darin keine Abkehr vom Thema, sondern eher eine Kurskorrektur: „Die Vorstellung, dass es eine Technologie gibt, die alles ersetzt, ist falsch. Das Modell Tankstelle in der Mobilität ist aktuell praktisch und universell. Zukünftig brauchen wir stattdessen ein Nebeneinander von Lösungen. Etwa Elektroantrieb für den Personenverkehr und Wasserstoff für Busse und Lkw“, sagt Utsch. Wasserstoff kann Teil der Antwort sein.
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die in der Studie aufgezeigten Möglichkeiten in kleine, realistische Projekte überführt werden können. Klar ist: Die Energiewende in der Region ist machbar, aber sie verlangt langen Atem, Flexibilität – und die Bereitschaft, sich von manchen Idealbildern zu verabschieden. Rainer Claaßen


