Ihr Warenkorb ist leer
Menü
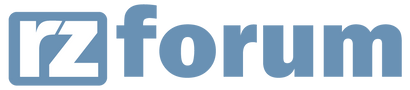
Aus der Steillage in die Zukunft
Juli 07, 2025 5 min lesen.

Weinbau Der „smarte Weinberg“ ist auf dem besten Weg, den Rebenanbau an der Mosel zu revolutionieren. Künstliche Intelligenz und Drohnentechnologie optimieren die Arbeit der Winzer
Zwischen schroffen Schieferhängen und jahrhundertealten Reben bahnt sich ein Wandel an. An der Mosel, einer der traditionsreichsten Weinregionen Europas, treffen bewährte Handarbeit und moderne Technologie aufeinander – und eröffnen dem Steillagenweinbau völlig neue Perspektiven. Künstliche Intelligenz, Sensorik, Robotik und 5G-Netze sollen den arbeitsintensiven und oft auch gefährlichen Alltag der Winzer erleichtern, die Qualität der Trauben sichern und den Weinbau zukunftsfähig machen. Zwei Forschungsprojekte, „smarter Weinberg“ und „NoLa“, zeigen derzeit eindrucksvoll, wiedas gelingen kann.
„Auch die Erkenntnisse zur Prognose von Pilzkrankheiten oder zur Optimierung von Düngeintervallen zeigen, wie präzise und wirkungsvoll die eingesetzten Technologien arbeiten.“
Kilian Franzen, Weingut Franzen in Bremm
Das Kooperationsprojekt „Smarter Weinberg“ läuft von 2021 bis 2025 unter der Leitung der Universität Koblenz. Neben Forschungspartnern wie Clemens Technologies (Weinbautechnik), Aerodcs (Luftbildfotografie) und Vision and Robotics (Robotik und Software) waren auch Praxisbetriebe wie die Weingüter Kilian Franzen in Bremm und FJ Weis in Zell eingebunden. Ziel war es, körperlich belastende und gefährliche Arbeiten wie Bodenbearbeitung, Entlaubung und Pflanzenschutz automatisierter Technik zu erleichtern.

Dazu wurden Maschinen mit vernetzten Sensoren und Multispektralkameras ausgestattet, die kontinuierlich Daten zu klimatischen Bedingungen, Bodenfeuchte und dem Gesundheitszustand der Reben erfassen. Diese Informationen werden in einer zentralen Datenplattform verarbeitet und analysiert, um Winzerinnen und Winzern finanzierte Entscheidungshilfen bereitzustellen.
Prof. Dr. Maria A. Wimmer, Leiterin der Forschungsgruppe E-Government an der Universität Koblenz, ist überzeugt vom Potenzial der KI im Weinbau: „Wir entwickeln webbasierte Anwendungen, die Winzer bei Bodenbearbeitung, Laubarbeiten und Spritzen unterstützen.“
Die Auswertung der Daten erfolgt unter anderem durch das an der Universität entwickelte KI-Informationsmanagementsystem (KIWI). Es bündelt alle relevanten Informationen und ermöglicht eine agronomisch finanzierte Steuerung der Maßnahmen im Weinberg. Zudem lassen sich aus den gesammelten Daten Rückschlüsse auf langfristige Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel ziehen. Dazu gehören etwa Veränderungen in der Bodenfeuchte, im Schädlingsdruck oder in der Ausbreitung pilzlicher Erkrankungen. „Unser Ziel ist es, nicht nur die Arbeit zu erleichtern, sondern auch ökologisch nachhaltige Prozesse zu fördern“, betont Prof. Wimmer.
Neben dem technologischen Fokus auf Automatisierung adressiert das Projekt auch die Notwendigkeit einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur. Die 5G-Abdeckung ist noch nicht überall gegeben, doch sie ist eine notwendige Voraussetzung für Echtzeitdatenverarbeitung im Weinberg. Das Schwesterprojekt „NoLa“ (Nomadisches Landnetz) widmet sich daher dem Aufbau von flächendeckenden 5G-Netzwerken in ländlichen Regionen. Mithilfe einer mobilen, wasserstoffbetriebenen 5G-Einheit sind Netzwerke auch dort möglich, wo bislang kein ausreichender Empfang besteht. Diese Entwicklung ist besonders das KI-Informationsmanagementsystem KIWI relevant. In Verbindung mit dem „smarten Weinberg“ entsteht so ein Gesamtsystem, das die digitale Transformation im Weinbau nicht nur punktuell, sondern strukturell verankert.
Matthias Weis vom Weingut FJ Weis in Zell an der Mosel ist einer der Winzer, die ihre Flächen für das Projekt zur Verfügung gestellt haben. Gemeinsam mit der Universität Koblenz wurden bestehende Maschinen mit Sensoren und Kameras ausgestattet, um Daten direkt im Weinberg zu sammeln: Gesundheitszustand der Reben, Trockenheit, Schädlingsbefall oder notwendige Düngeintervalle. Diese Daten wurden in Echtzeit verarbeitet und über das zentrale Informationsmanagementsystem dem Winzer zur Verfügung gestellt. „Das System erkennt mittlerweile selbst, wo gegossen oder gedüngt werden muss – und gibt Empfehlungen, die wir im Weinberg oft erst viel später erwähnen würden“, zeigt sich Weis begeistert. „Der Weinbau in Steillagen ist oft gefährlich, körperlich extrem anspruchsvoll und aufwendig. Wenn Technologien helfen können, diese Arbeiten sicherer und effizienter zu machen, dann ist das eine große Chance.“ Kilian Franzen in Bremm an der Mosel beteiligte sich mit seinem Weingut ebenfalls an dem Projekt. „Anfangs war ich skeptisch“, steht er. Inzwischen blickt er deutlich zuversichtlicher auf die Entwicklung: „Die Kompetenz der Projektpartner hat mich überzeugt.“ Besonders der Einsatz einer seilgesicherten, ferngesteuerten Raupe hat sich als sicherer und bodenschonender Ersatz für herkömmliche Geräte bewährt. Sie reduziert nicht nur die Unfallgefahr, sondern schützt auch die Gesundheit der Arbeiter, die nicht länger direkt mit Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kommen müssen. Ergänzt wird die Technik durch Drohnen, die präzise über die Rebzeilen gesteuert, um den Pflanzenschutz
„Der Weinbau in Steillagen ist oft gefährlich, körperlich extrem anspruchsvoll und aufwendig. Wenn Technologien helfen können, diese Arbeiten sicherer und effizienter zu machen, dann ist das eine große Chance.“
Matthias Weis, Weingut FJ Weis in Zell

Gezielt auszubringen – effizienter und ressourcenschonender als der bisher übliche Hubschraubereinsatz. „Auch die Erkenntnisse zur Prognose von Pilzkrankheiten oder zur Optimierung von Düngeintervallen zeigen, wie präzise und wirkungsvoll die eingesetzten Technologien arbeiten.“
Auch wenn manche Visionen wie die Idee eines Roboters, der autonom in Steillagen betrieben wird, aus praktischen Gründen verworfen werden müssen, haben sich viele Komponenten als tragfähig erwiesen. Für die zukünftige Marktreife sei allerdings ein Anschlussprojekt notwendig, so Franzen.
Trotz der positiven Ergebnisse gibt es aber noch bürokratische Hürden zu überwinden. So verweist Franzen auf aktuelle rechtliche Auseinandersetzungen zum Schutz regionaler Schmetterlingsarten wie des Apollofalters, die durch den Einsatz von Spritzdrohnen eingeschränkt werden könnten. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden, aber die Genehmigungsverfahren sind komplex. Sollte die Drohnentechnik regelmäßig zugelassen werden, erfolgt sie in jedem Fall deren dauerhaften Einsatz.
Die Projekte „smarter Weinberg“ und „NoLa“ zeigen, wie Digitalisierung auch in Kulturlandschaften wie den Steillagen der Mosel funktionieren kann, ohne die Identität der Region anzutasten.
Für die beteiligten Weingüter war das Projekt nicht nur eine technische, sondern auch eine persönliche Bereicherung. „Wir haben keine Fördermittel erhalten, aber viel Zeit investiert – und ich habe es keine Sekunde bereut“, sagt Matthias Weis. „Es hat mir gezeigt, wie wir unsere Arbeit besser, sicherer und nachhaltiger gestalten können – ohne unsere Tradition aufzugeben.“ Und auch aus Kilian Franzen spricht die Leidenschaft für seinen Beruf: „Auch wenn die Bewirtschaftung der steilsten Weinberge Europas eine der körperlich anstrengendsten Aufgaben ist, macht uns der Erhalt der Kulturlandschaft und die Weiterführung jahrhundertealter Tradition stolz.“
Die KI-Projekte im Weinbau
Smarter Weinberg
-
Projektlaufzeit: 17.11.2021 bis 31.01.2025, Fördervolumen: 3,97 Millionen Euro
- Ziel: Entwicklung webbasierter Anwendungen zur Automatisierung von Weinbauarbeiten
NoLa
Schwesterprojekt zu „smarter Weinberg“
-
Laufzeit: 01.10.2023 bis 31.12.2024, Fördervolumen: 1,77 Millionen Euro, gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)
-
Ziel: nomadische 5G-Netze für ländliche Räume
Herausforderungen
-
5G-Versorgung: fehlende Anbindung in ländlichen Gebieten, hohe Anforderungen an Datenraten und Latenz
- Lizenzierung: Komplexe Strukturen erfordern innovative Modelle für Frequenznutzung und Beantragung
Projektergebnisse
-
Kartierung der Weinberge mithilfe von Drohnenaufnahmen und Entwicklung digitaler Zwillinge
-
5G Campusnetzanlage mit Edge Cloud für die lokale Netzkommunikation bei der Echtzeitbearbeitung
-
Unbemannte Robotikplattform für teilautonomes Entlauben und Bodenbearbeitung, gesichert mit Seilwinde, Batteriebetrieb
-
Einsatz von Spritzdrohnen zur Ausbringung von Dünge-/Spritzmittel
-
Einsatz von Drohnen zur Kartierung der Weinberge und dem Monitoring
- IoT-Sensorik (Wetterstationen, Temperaturfühler, Blattfeuchtesensoren)
-
Datenplattform für Sammlung und Auswertung der Bild- und Sensordaten
- KI-basiertes Weinberg-Informations-Managementsystem KIWI Vorteile
Vorteilesindunter anderen:
-
Keine Bodenverdichtung und Erosion
-
Einsatz für unterschiedliche Lagen und Bedingungen.
-
Arbeitserleichterung bei knappen Arbeitskräften.
- Sicherheitsgewinn für den Anwender.
-
Kein Arbeiten im Sprühnebel, keine Absturzgefahr
- Schonung von Anwohnern und Touristen
- Geringe Geruchsbelästigung
- Exaktes sprühen auf 1-2 cm nach GPS
-
Günstiger als Raupeneinsatz und in der Regel günstiger als Helikopter

Der Einsatz von Drohnen und Hubschraubern zum Pflanzenschutz ist rechtmäßig
Zwei neue Urteile des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 27. und 28. Mai 2025 bestätigen die Rechtmäßigkeit der Drohnen- und Hubschraubereinsätze zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Teillagenweinbau.
In einem abgetrennten Teil des Eilverfahrens hatte das Gericht zunächst die Ausbringung bestimmter Pflanzenschutzmittel per Hubschrauber als rechtmäßig bewertet. Die Argumentation dieses Beschlusses gelte erst recht für die Ausbringung per Drohne, betonte das Verwaltungsgericht.
Damit lehnte das Gericht den Antrag der deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Ausbringung per Hubschrauber im Eilverfahren ab. Die genehmigten Maßnahmen sind mit umfangreichen Auflagen verbunden, die auch den Artenschutz etwa den des Apollofalters – berücksichtigten.
Damit sind die Einsätze per Drohne 2025 rechtssicher möglich. Dies ist eine wichtige Entscheidung für die Arbeit im Steillagenweinbau. Die Drohne reduziert den Pflanzenschutzmitteleinsatz, schont die Umwelt, schützt die Gesundheit der Winzerinnen und Winzer und macht den Steillagenweinbau zukunftsfähig.
Gudrun Katharina Heurich
Chefredakteurin
Gudrun Katharina Heurich ist seit 2020 als freie Autorin für die WIRTSCHAFT tätig und übernahm 2023 die Chefredaktion. Die gelernte Redakteurin verantwortet die publizistischen und organisatorischen Redaktionsabläufe und verfasst diverse Artikel zu Wirtschaftsthemen.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



