Ihr Warenkorb ist leer
Menü
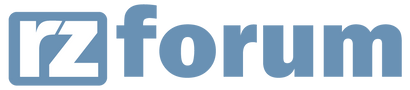
Lieber verwalten als gestalten?
Juli 07, 2025 5 min lesen.

Konkurrenz Immer mehr Erwerbstätige zieht es in den Staatsdienst. In der privaten Wirtschaft kommt diese Entwicklung überhaupt nicht gut an. Vorwürfe werden laut, der Staat grabe vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels zusätzlich das Wasser ab.
Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Kommunen ist in der Zeit zwischen 2012 und 2022 um 14 Prozent gestiegen. Das geht aus den Ergebnissen einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Demnach arbeiteteen 2022 gut 4,8 Millionen
„Während Unternehmen Automatisierung nutzen und Arbeitsprozesse verschlanken, werden im öffentlichen Dienst neue Stellen geschaffen statt alte Aufgaben und Prozesse zu hinterfragen und zügig zu digitalisieren“
Prof. Dr. Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden und Professor für Finanzwissenschaft an der TU Dresden
Menschen als Beamte oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund 584 000 Beschäftigte weniger. Während der Ampelregierung wurden allein in den Bundesministerien 1629 zusätzliche Planstellen geschaffen, ein Plus von acht Prozent.
Für Studienabgänger ist Vater Staat auch heute noch der beliebteste Arbeitgeber. Die Beratungsgesellschaft EY (Ernst and Young) hat 2000 junge Menschen zu ihren beruflichen Plänen befragt. 26 Prozent der Uniabsolventen sahen ihre Zukunft im öffentlichen Dienst. Bläht sich die Verwaltung auf Kosten der Privatwirtschaft auf, die händeringend Arbeitskräfte sucht?„Das ist mehr als bedenklich“,meint Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemiepumpen GmbH in Ransbach-Baumbach. „Die Freude am Unternehmertum, an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit ist leider auf dem Rückzug. Junge Menschen, die zum Staat gehen, fehlen uns in der freien Wirtschaft. Letztlich verschärft der Staat damit den Fachkräftemangel vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen.“ Sein Unternehmen habe diese Entwicklung noch nicht unmittelbar zu spüren bekommen. Aber ein befreundeter Unternehmer habe erst kürzlich erhebliche Probleme bekommen, weil der Programmierer seinen Betriebs einen Job in der Stadtverwaltung den Vorzug gegeben hatte. Der Staat lockt mit Arbeitsplatzsicherheit, planbaren Einkommenssteigerungen, geregelten Arbeitszeiten und guten Aufstiegschancen. Diesen Verlockungen wollen viele nicht widerstehen.
Auch Prof. Dr. Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden und Professor für Finanzwissenschaft an der TU Dresden, glaubt, dass der Personalaufbau im öffentlichen Sektor zum Problem für die Privatwirtschaft wird. Der öffentliche Sektor habe es beispielsweise weitgehend versäumt, in der Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben, um mit Effizienzgewinnen Personal einzusparen. Ein Beschäftigungsaufwuchs dürfe jedoch nicht in Bausch und Bogen verurteilt werden. „Mehr Persönlich, beispielsweise im Pflegebereich, kann durchaus sinnvoll sein. Aber beim Stellenaufbau auf breiterer Front, wie wir ihn derzeit erleben, sind Zweifel an der Sinnhaftigkeit angebracht“, sagt Thum. „Während Unternehmen Automatisierung nutzen und Arbeitsprozesse verschlanken, werden im öffentlichen Dienst neue Stellen geschaffen, statt alte Aufgaben und Prozesse zu hinterfragen und zügig zu digitalisieren.“ Der Wirtschaftsforscher sieht den öffentlichen Sektor und die private Wirtschaft in einer Konkurrenz, die sich angesichts der rückläufigen Erwerbstätigenzahlen weiter zuspitzen wird. „Der Staat sollte sich stärker auf Digitalisierung und Prozessoptimierung konzentrieren, um mit den knapper werdenden Ressourcen effizienter umzugehen“, sagt Thum.
Für den Unternehmer Munsch liegt einer der wesentlichen Gründe für die Aufblähung des Staatsapparates in der Flut von Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und bürokratischen Auflagen. Munsch möchte diese Kritik nicht als Pausenverurteilung von Behörden und Verwaltungen verstehen. „Ich weiß, dass viele Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst selbst mit Überforderungen zu kämpfen haben, weil sie immer wieder mit neuen Ausführungsbestimmungen und Einzelfallregelungen konfrontiert werden.“
Für Munsch ist „Vereinfachung“ das Schlüsselwort für mehr Effizienz und eine Verschlankung der Verwaltung. Er nennt Beispiele. „Früher haben wir eine Steuerbilanz erstellt. Heute müssen wir zusätzlich noch eine Handelsbilanz vorlegen. Auf die komplizierte Verrechnung der Gewerbesteuer könnte verzichtet werden, wenn der Staat sich zu einer Reformierung dieser zutiefst ungerechten Steuer entschließen würde.“
Im Rahmen der Arbeitssicherheitsüberprüfung müssen die Staplerfahrer der Firma Munsch neben dem Staplerführerschein und jährlicher Sicherheitsschulung jetzt auch noch eine Tauglichkeitsprüfung durch den Betriebsarzt testiert bekommen. Alles muss belegt und dokumentiert werden. „Unsere Firmenwagen müssen neben der alle zwei Jahre turnusmäßigen TÜV-Prüfung zusätzlich jährlich zu einem Werkstattcheck, den die Unfallverhütungsvorschrift verlangt. Die Firmenwageninhaber müssen außerdem jährlich eine Sicherheitsunterweisung zum Fahren des Autos absolvieren.“ Man fragt sich, ob das wirklich alles sein muss. Auch der Staat„ Im Rahmen der Arbeitssicherheitsüberprüfung müssen die Staplerfahrer der Firma Munsch neben dem Staplerführerschein und jährlicher Sicherheitsschulung jetzt auch noch eine Tauglichkeitsprüfung durch den Betriebsarzt testiert bekommen. Man fragt sich, ob das wirklich alles sein muss. Ob das wirklich alles sein muss.
Auch der Staat könnte sich am „Lean Management“ vieler Unternehmen ein Beispiel nehmen. Die vielen Auflagen, Pflichten und lästigen Nebentätigkeiten belasten, so Munsch, die wesentlichen Ziele unternehmerischen Handelns: wachsende Produktivität, robuste Wettbewerbsfähigkeit und stabile Wertschöpfung. Munsch plädiert nicht für radikale Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst. „Aber vielleicht wäre es sinnvoll, mit einem Einstellungsstopp die Beschäftigtenzahlen erst mal einzufrieren, statt sie immer weiter steigen zu lassen.“ Für den Ifo-Experten Thum wird die Marktwirtschaft im Wettbewerb des öffentlichen Sektors stehen
„Junge Menschen, die zum Staat gehen, fehlen uns in der freien Wirtschaft. Letztlich verschärft der Staat damit den Fachkräftemangel vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen.“
Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemiepumpen GmbH in Ransbach-Baumbach
bei gleichzeitigem Schrumpfen der Erwerbstätigenzahlen durch das Ausscheiden der Babyboomer mit flexiblen Anpassungs- und Ausweichmöglichkeiten reagieren müssen. Für ihn sind Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung, die stärkere Förderung einer Rückkehr von Müttern in Vollzeitbeschäftigung, eine erhöhte Zuwanderung von Fachkräften sowie künstlerische und mehr Automatisierung wichtige Stellschrauben. „Manches wird auch ganz wegfallen und neue Kapazitäten freisetzen.“

Angesichts der intensiv geführten Debatte über Fachkräftemangel und Zuwanderung verweist Munsch auch darauf, wie viele exzellent ausgebildete junge Menschen jedes Jahr Deutschland als Auswanderer verlassen und ihr Glück in anderen Ländern Europas oder in Übersee suchen. Entscheidende Gründe dafür sind geringere Steuern, also mehr Netto vom Brutto, entspanntere Lebensverhältnisse und weniger Regulierungswut als in Deutschland. „Wir müssen ein Auge darauf haben, dass nicht immer mehr Belastungen dazu führen, dass immer mehr gehen.“
Wir sind dann mal weg
Die Abwanderung von heimischen Fachkräften ins Ausland ist ein häufig übersehener, aber sehr wichtiger Standortfaktor. Denn in der Mehrheit gehen hochqualifizierte Fachkräfte. Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) ermittelt hat, verfügen fast drei Viertel von ihnen über ein abgeschlossenes Studium oder eine hochwertige Fachausbildung. Die beliebtesten Ziele deutscher Auswanderer waren nach Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) für das Jahr 2020 die Schweiz (rund 307 000 deutsche Staatsbürger) und Österreich (rund 200 000). Länder also, mit wenigen kulturellen Unterschieden und so gut wie keine Sprachbarrieren. Aber auch Spanien, Frankreich, die Niederlande und die skandinavischen Staaten sind beliebte Ziele der Auswanderungswilligen. Die Wanderstatistik des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigt weiterhin, dass im Jahr 2021 12.612 deutsche Staatsbürger Rheinland-Pfalz ins Ausland verlassen haben, allerdings kehrten im gleichen Zeitraum 9660 Personen aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz zurück.
Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)/ Statistisches Bundesamt (Destatis)
Hans-Rolf Goebel
Redakteur
Hans-Rolf Goebel ist seit 2018 als Freier Autor für die WIRTSCHAFT tätig. Der gelernte Journalist verantwortet die Beiträge für das Topthema als Aufmacher der Zeitung und für das Dossier.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



