Ihr Warenkorb ist leer
Menü
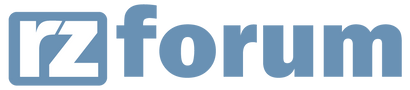
Voice-KI im Praxisbetrieb
Juni 27, 2025 3 min lesen.

Im Februar dieses Jahres diskutierten der Rechtsanwalt Klemens M. Hellmann LL.M., von der Kanzlei Martini Mogg Vogt und der KI-Experte Dennis Mittelmann, Geschäftsführer der TrendView GmbH, im WIRTSCHAFT-Campus-Podcast über die Chancen und rechtlichen Herausforderungen von Voice-KI in Unternehmen. Der damalige Befund – Deutschland sei noch immer ein analoges Land – wirkte zunächst wenig ermutigend.
In der aktuellen Podcastfolge stellen beide fest: Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenommen. Laut Bitkom setzen mittlerweile 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz ein – im Jahr 2022 waren es noch neun Prozent. Weitere 37 Prozent diskutieren oder planen konkrete Einsatzszenarien. Zugleich kündigte die EU im Februar 2025 milliardenschwere Investitionen in KI an, und OpenAI eröffnete im selben Monat ein erstes Deutschland-Büro in München.
Auch Voice-KI hält zunehmend Einzug in mittelständische Unternehmen – nicht mehr als Pilotprojekt, sondern als fester Bestandteil betrieblicher Prozesse. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist der Betonsteinhersteller EHL mit Sitz in Kruft. Das Unternehmen nutzt seit Anfang 2025 eine KI-gestützte Telefonassistenz, um Anrufe automatisch zu bearbeiten und Beratungstermine effizient zu koordinieren und Angebote individueller zu erstellen. Die Software führt dabei natürliche Dialoge, fragt Informationen ab und übernimmt eigenständig die nächsten Schritte wie Terminvereinbarung oder E-Mail-Versand. Dadurch werden Mitarbeiter entlastet, Kundenanfragen schneller beantwortet und besser auf Gespräche vorbereitet – und das Unternehmen bleibt auch bei knapper Personaldecke durchgehend erreichbar.
„Dank der Voice-KI können wir Beratungsanfragen strukturierter aufnehmen und deutlich schneller reagieren. Das entlastet unsere Vertriebsmitarbeiter spürbar und verbessert die Kundenkommunikation insgesamt“, sagt Marco Denecke, Leiter Marketing bei EHL.
Laut Bitkom gehen fast 70 Prozent der Unternehmen davon aus, dass KI-Anwendungen wie Voicebots bereits heute oder in naher Zukunft zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit beitragen.
Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Rückmeldungen wider, die Dennis Mittelmann von seinen Kunden erhält – viele berichten von messbaren Verbesserungen im Service und zufriedeneren Anrufern. Im ersten Podcast hat Mittelmann bereits demonstriert, wie die Lösung klingt: Der digitale Agent meldet sich mit sympathischer Stimme, fragt freundlich nach Kontaktdaten, stimmt konkrete Terminvorschläge mit dem Anrufer ab – und trägt diese direkt in einen digitalen Kalender ein. Die Simulation wirkt so überzeugend, dass sie selbst erfahrene Zuhörer überrascht.
Doch was technologisch beeindruckt, wirft juristisch neue Fragen auf. „Der Einsatz des Voice-KI-Systems muss als KI kenntlich gemacht werden, weil Entwickler großen Aufwand betreiben, sie möglichst menschlich klingen zu lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss transparent erfolgen – das verlangen sowohl die DSGVO als auch die KI-Verordnung der EU“, betont der zertifizierte Datenschutzbeauftragte Klemens M. Hellmann. Der Einsatz solcher Systeme berührt sensible Themen des Datenschutzrechts.

Im Podcast thematisieren Hellmann und Mittelmann unter anderem die Abläufe von der Bedarfs- zur Machbarkeitsanalyse, die Ermittlung der rechtlichen Anforderungen anhand der Einstufung der Risiken nach KI-Verordnung („AI-Act“), die Dokumentation der Datenverarbeitung und die Frage, wie Unternehmen ihren Informationspflichten gegenüber Anrufern und ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde gerecht werden können. Bei dem zeitlich abgestuft umzusetzenden europäischen AI-Act müssen Unternehmen nachweisen können, dass ihre KI-Anwendungen auch gesetzeskonform sind.
In der aktuellen Podcastfolge werden deshalb nicht nur praxisnahe Anwendungsszenarien beleuchtet, sondern auch die juristischen Anforderungen deutlich in den Fokus gerückt. „Es reicht nicht, die Technik zu implementieren. Unternehmen müssen auch organisatorisch und rechtlich vorbereitet sein – von den Einführungsdokumenten gemäß KIVerordnung über die Kundeninformationen bis zu den Mitarbeiterschulungen“, erklärt Hellmann. Die Einführung solcher Systeme ist demnach keine reine IT-Frage, sondern eine strategische Entscheidung mit rechtlicher Tragweite. Hellmann zieht einen Vergleich zum Bau: „Die Umsetzung von KI in Unternehmen ähnelt einem Bauzeitenplan. An jeder Etappe müssen neue Entscheidungen getroffen werden – sowohl auf technischer als auch auf juristischer Ebene.“ Er verweist auf die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung, auf die rein betriebliche Abwägung zwischen einer stilsicheren und einer rechtssicheren Umsetzung sowie auf die datenschutzrechtliche Tragweite von Sprachaufzeichnungen.
Neben der juristischen Einordnung zeigt die aktuelle Folge auch, wie schnell sich der Markt an neue Begebenheiten anpasst. „Wir beobachten, dass die Nachfrage für Sprach-KI im Kundenservice steigt und dass Unternehmen deutlich routinierter in ihren Anfragen sind, als noch vor einem Jahr“, sagt Mittelmann. „Die Fragen sind konkreter, die Anforderungen klarer – viele kommen mit Vorwissen und gezieltem Interesse auf uns zu.“ Gleichzeitig ist die Offenheit gegenüber digitalen Assistenten gewachsen. Während früher ein Gespräch mit einem Menschen als unverzichtbar galt, werden KI-Systeme mittlerweile akzeptiert – allerdings nur, wenn sie zuverlässig funktionieren und erkennen, wann menschliches Eingreifen nötig ist. „Gerade bei dringenden Anliegen, etwa technischen Störungen, ist ein intelligentes Fallbacksystem entscheidend”, betont Mittelmann. „Die KI erkennt Schlüsselbegriffe wie ‚Notfall‘ und leitet das Gespräch sofort an einen menschlichen Ansprechpartner weiter.“ Auch sichere Schnittstellen und regelmäßige Softwareupdates sollten bei KI-Projekten mitbedacht werden, da die Entwicklung der KI so schnell voranschreitet.
Voice-KI hat sich somit längst von einer experimentellen Technologie zu einem praxisreifen Werkzeug entwickelt – mit wachsender Bedeutung für die strategische Ausrichtung vieler Unternehmen.
Der aktuelle Podcast zeigt anschaulich, wie eine KI-Systemimplementierung im Unternehmen abläuft und gibt erneut praxisnahe Einblicke, wie sich Unternehmen mit KI-Lösungen zukunftssicher aufstellen können – technologisch, organisatorisch und rechtlich. Wer den Anschluss nicht verpassen will, findet in der Folge fundierte Orientierung.
Die neue Episode ist ab sofort abrufbar.
Internetseiten: Barrierefreiheit wird Pflicht – auch für Sprach-KI
Ab dem 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen, ihre digitalen Angebote im B2C-Bereich barrierefrei zu gestalten – auch, wenn sie Sprach-KI oder andere KI-gestützte Systeme zur Kundeninteraktion einsetzen.
Was bedeutet das für Unternehmen?
- Webseiten und Systeme prüfen: bei Angeboten, die auf Vertragsabschlüsse abzielen (z.B. Produktbuchungen, Terminvereinbarungen), müssen die Webseiten barrierefrei zugänglich sein.
- Sprach-KI einbeziehen: Auch Voicebots und KI-Assistenten müssen verständlich, zugänglich und mit Hilfsmitteln kompatibel sein.
- Frühzeitige Anpassung empfohlen: „Unternehmen sollten ihre Internetseiten und den Zugang zu KI-Systemen jetzt auf Barrierefreiheit prüfen“, rät Rechtsanwalt Klemens M. Hellmann.
Das brandaktuelle Thema wird auch am Ende der neuen Podcastfolge besprochen.

Voice-KI im Praxisbetrieb
Juni 27, 2025 3 min lesen.
Voice-KI wird für Mittelständler zum Gamechanger – und stellt gleichzeitig neue rechtliche Anforderungen. Im Podcast erklären Dennis Mittelmann und Klemens M. Hellmann, wie Unternehmen mit KI effizienter arbeiten und dabei DSGVO, AI-Act & Barrierefreiheit im Blick behalten.

Geschäftsführerhaftung: Wie Sie persönliche Risiken vermeiden und rechtlich auf der sicheren Seite bleiben
April 25, 2025 2 min lesen.
Die persönliche Haftung ist eine oft unterschätzte Gefahr für Führungskräfte. Wann wird aus einer unternehmerischen Entscheidung ein rechtliches Risiko? Und wie schützen Sie sich wirksam vor Haftungsfallen?

Die Zukunft der Kommunikation: Wie Voice-KI Unternehmen revolutioniert
Februar 28, 2025 1 min lesen.
Sprach-KI revolutioniert die Kundenkommunikation: lernfähig, individuell und immer einsatzbereit. Doch wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Zwei Experten diskutieren, wie Unternehmen von Voice-KI profitieren können.

Erbschaft ohne Risiko: Wie das Behindertentestament Familien unterstützt
Dezember 17, 2024 1 min lesen.
Wie können Eltern ihr Kind mit Behinderung erbrechtlich absichern, ohne dass Sozialleistungen verloren gehen? Im Lernvideo erklärt Fachanwältin Anna Wilbert das Prinzip des Behindertentestaments – mit klaren Tipps für eine rechtssichere Nachlassgestaltung.


