Ihr Warenkorb ist leer
Menü
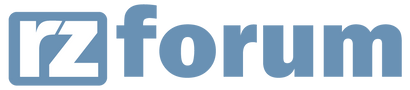
Geld & Erfolg | Können textile Schutzhüllen und künstliche Wolken Mensch und Natur helfen?
August 25, 2023 4 min lesen.

Blick auf den größten Gletscher Österreichs im Sommer 2018: die Pasterze am Fuße des Großglockners – So schnell wie im vergangenen Jahr sind Österreichs Gletscher seit Messbeginn noch nie zurückgegangen. Der Alpenverein warnt vor der möglichen Zukunft: eisfrei bis spätestens 2075.
Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com
Geoengineering Innovation hat viele Gesichter: Methoden und Technologien für den Klimaschutz
Von Sabine Frank
Die Forschung tüftelt an Lösungsansätzen, um das Schwinden der Gletscher aufzuhalten oder zu bremsen und somit noch zu retten, was möglich ist. Zahlreiche Projekte und Überlegungen lassen sich dem Feld des Geoengineerings zuordnen, das Eingriffe in die geochemischen oder biochemischen Kreisläufe unseres Planeten umfasst. Damit soll das Klima oder die Umwelt auf der Erde durch menschliche Eingriffe beeinflusst werden.
Die meisten Vorschläge fallen in zwei Gruppen: Solar Radiation Management (SRM) und Carbon Dioxide Removal (CDR). Bei SRM soll das Sonnenlicht reflektiert oder blockiert werden, um die Erderwärmung zu reduzieren. Beispielsweise könnten große Mengen an Schwefeldioxid in die Atmosphäre freigesetzt werden, um eine Art künstlichen Vulkanausbruch zu simulieren, der das Sonnenlicht blockiert. Mit der CDR-Technologie soll CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden, um den Treibhauseffekt zu reduzieren. Als Methoden kommen zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen, das Vergraben von Kohlenstoffdioxid oder die Verwendung von chemischen Absorptionsverfahren in Frage.
Schutzhülle für Gletscher
Um ihre Gletscher vor dem Verschwinden zu retten, kamen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) auf die Idee, Textilplanen in großem Maßstab über das Eis zu legen. Die Tücher können Schnee und Eis isolieren und in der Folge die Gletscherschmelze reduzieren. In Skigebieten wird dieser kleine menschliche Eingriff in die Umwelt bereits seit vielen Jahren angewendet – etwa auf dem Gurschengletscher am Gemsstock in der Schweiz. Dort schützt eine solche Gletscherabdeckung eine Rampe aus Eis, über die Skitouristen von der Bergstation hinunter auf die Piste gelangen.
Glaziologe Matthias Huss von der ETH sagte im „Deutschlandfunk“, man könne den Gletscherrückgang hier wirklich reduzieren, teilweise sogar wieder leicht aufbauen, aber es sei sehr aufwändig. In der Schweiz bedeckt man etwa 0,02 Prozent der Gletscherflächen mit Geotextilien. Alle Schweizer Gletscher mit dieser Technik zu schützen, würde über eine Milliarde Euro pro Jahr kosten.
Andere negative Umweltfolgen lassen jedoch aufhorchen: Die Tücher bestehen aus Synthetik und verwittern. Es entsteht Mikroplastik, das in den hydrologischen Kreislauf gerät und Auswirkungen auf Wasserqualität und Umwelt hat.
Künstlicher Vulkanausbruch
Vielleicht kann das „solare Geoengineering“ helfen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen? Dabei soll eine höhere Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlung beziehungsweise eine verringerte Absorption auf der Erde erreicht werden. Das könnte etwa mit Schwefelpartikeln passieren, die in 15 bis 20 Kilometern Abstand zur Erde versprüht werden. Dadurch entstehen winzige Schwebteilchen, die ähnlich wie Wolken Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektieren, bevor diese die Erdoberfläche erreicht. Dies kann zumindest theoretisch die globale Durchschnittstemperatur senken. Die Methode ahmt einen natürlichen Vorgang nach: Sie simuliert einen Vulkanausbruch, bei dem Vulkane ihre Partikel in die Stratosphäre schleudern. Die Folge: Die Temperaturen sinken tatsächlich.
Noch Forschungsbedarf
Allerdings könnte die Injektion von Schwefeldioxid in die Atmosphäre die Ozonschicht auch schädigen, Atemwegserkrankungen verursachen und sauren Regen erzeugen, warnen Wissenschaftler der UCLA (University of California, Los Angeles). Bisher nicht ausreichend untersucht wurde zudem, wie sich eine geringere Sonnenstrahlung auf die Landwirtschaft und die Ökosysteme verschiedener Regionen auswirken würde. Auch die Folgen für die Gesundheit der Menschen seien unklar. Manche Partikel könnten die Ozonschicht angreifen. Damit stiege das Risiko von Hautkrebs.
Der Weltklimarat weist darauf hin, dass Methoden zur Abwehr der Sonnenstrahlen beim Klimaschutz nicht die zentrale Strategie sein könnten. Sie sollten diese höchstens ergänzen. Auch seien sie noch zu wenig erforscht und sehr riskant. Bleibt noch CDR zur Klimarettung.
Negative Emissionen
Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Um dieses Klimaziel zu erreichen, ist nicht nur eine drastische Reduzierung der Emissionen erforderlich, der Atmosphäre muss auch CO2 entzogen und dauerhaft gebunden oder gespeichert werden. Hunderte Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid sollen mit der Methode des Carbon-Dioxide-Removal aus der Luft geholt und abgespeichert werden. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung weist darauf hin, dass Machbarkeit, realistische Entnahmemengen und Umsetzungsbedingungen der CDR-Methoden noch nicht ausreichend erforscht seien. Deshalb können derzeit noch keine abschließenden Abschätzungen gegeben werden, wie viel CO2 in Deutschland aus der Atmosphäre entnommen und dauerhaft gespeichert werden kann.
Keine Prokrastination
Es wird deutlich: Die schnelle und tiefgreifende Reduktion von CO2- Emissionen ist von größter Bedeutung. Denn je näher wir der Erreichung unserer Klimaziele kommen, desto weniger werden wir auf Methoden und Technologien zur aktiven Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und die dauerhafte Speicherung zur Kompensation von nicht zu vermeidenden Emissionen angewiesen sein.
Zum Begriff: Geoengineering
Der Begriff Geoengineeringbezeichnet vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geochemische oder biogeochemische Kreisläufeder Erde. Als Ziele derartiger Eingriffe werden hauptsächlich das Abbremsen der anthropogenen globalen Erwärmung, etwa durch den Abbau der CO2- Konzentration in der Atmosphäre, und die Verringerung der Versauerung der Meere genannt.
Unterschieden werden Projekte zum Solar Radiation Management (SRM),die einfallende Sonnenstrahlung reduzieren sollen, und zum Carbon Dioxide Removal (CDR),die Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre entfernen und möglichst dauerhaft speichern sollen.
Rekordschmelze für die österreichischen Gletscher
Noch nie verzeichnete der Alpenverein des Landes einen größeren Gletscherschwund als im Jahr 2022.Wie der Verein Ende März mitteilte, gingen die Gletscher Österreichs im Jahr 2022 um 28,7 Meterzurück.
„Dieses Ergebnis erklärt sich aus der Kombination unterdurchschnittlicher Schneemengen im Winter und einer erneut langen und sehr warmen Schmelzperiode, die schon an der Monatswende Mai/Juni einsetzte und bis in den September hinein andauerte“, analysierten Gerhard Liebund Andreas Kellerer-Pirklbauer,Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes.Der aktuell und in Zukunft wohl weiter herrschende drastische Gletscherschwund mache langfristig die österreichischen Alpen so gut wie eisfrei – „optimistisch“ sei dies 2075, wahrscheinlich aber deutlich früher.
Pariser Klimaabkommen
Das „Übereinkommen von Paris“ wurde am 12. Dezember 2015auf der Weltklimakonferenz in der französischen Hauptstadt beschlossen. Die drei Hauptzieledes Abkommens sind in Artikel 2festgehalten:
- Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur
- Senkung der Emissionen und Anpassung an den Klimawandel
- Lenkung von Finanzmitteln im Einklang mit den Klimaschutzzielen.
Konkret heißt es, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, auf jeden Fall aber auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, beschränkt werden soll.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.


