Ihr Warenkorb ist leer
Menü
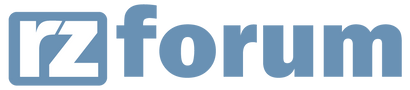
Kommunen unter Druck
Oktober 31, 2025 5 min lesen.

Besonders hoher Investitions- und Renovierungsbedarf besteht in den rheinland- fälzischen Landkreisen und Gemeinden bei den Schulen. Außerdem gilt ab dem Schuljahr 2026/27 der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule für alle Schulanfänger. Rheinland-Pfalz erweitert dieses Recht schrittweise bis zum Schuljahr 2029/30 auf alle Grundschulklassenstufen. Das erfordert vielerorts zusätzliche Raumkapazitäten.
Foto: 1take1shot/stock.adobe.com
Haushaltsdefizit
Der Investitionsrückstand in den Kommunen ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Prozent auf 215,7 Milliarden Euro gestiegen. Das ergibt eine aktuelle Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) für die KfW. Neun von zehn Gemeinden blicken pessimistisch in die Zukunft.
Nein, ein Schwarzmaler ist Moritz Petry nicht. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz ist er vielmehr besorgter Realist, wenn er die desolate Finanzlage der kommunalen Ebene im Bundesland beschreibt. „Die Kommunen müssen schultern, was Bund und Land als Legislative mit ihren Gesetzen vorgeben. In diesen Gesetzen werden Sozialleistungen festgeschrieben, die in Anspruch und Höhe detailliert definiert sind. Die Landkreise und Verbandsgemeinden sind dann die Zahlmeister, weil nicht alles erstattet wird.“
Die kommunale Ebene hat in diesem Prozess kaum Möglichkeiten, aktiv Einfluss nehmen zu können. Die Gemeinden müssen allerdings einen Eigenanteil zahlen und die personellen Kapazitäten für die Umsetzung der Gesetzesvorgaben stellen. Das führt zu dem Ergebnis, dass viele Landkreise und kreisfreien Städte immer tiefer in die roten Zahlen rutschen und ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen können. Das im deutschen Staatsrecht verankerte Konnexitätsprinzip (wer bestellt, der bezahlt), nach dem die für eine Aufgabe zuständige staatliche Ebene auch für die Wahrnehmung der Aufgabe verantwortlich ist, wurde immer stärker durchlöchert. Die Kommunen verzweifeln daran, dass ihnen bestimmte Aufgaben des Bundes (oder des Landes) übertragen werden, diese aber ihrerseits nicht für die vollen Kosten aufkommen.
„Die Kommunen müssen schultern, was Bund und Land als Legislative mit ihren Gesetzen vorgeben."
Moritz Petry, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz
„Es fehlt an Fairness im Finanzsystem“, sagt Petry. „25 Prozent der staatlichen Ausgaben sind bei den Kommunen angesiedelt. Sie erhalten aber nur 14 Prozent der staatlichen Steuereinnahmen. Fördergelder fangen die Unterdeckung von elf Prozent nicht auf. Von der Umsatzsteuer erhält die kommunale Ebene gerade einmal zwei Prozent. Sechs Prozent wären in unseren Augen gerecht und angemessen.“
Petry glaubt nicht, dass hinter der „permanenten Belastung von oben“, wie er sie nennt, böser Wille steckt. „In den allermeisten Fällen ist es schlicht Unwissenheit darüber, welche weitgehenden finanziellen und personellen Auswirkungen ein Berliner Gesetzgebungsakt auf Städte und Gemeinden hat.“
Viele Gesetze seien praxisfern und man spüre, wie groß die Kluft zwischen der Bundespolitik und der kommunalen Ebene sei. Petry plädiert deshalb dafür, dass bei Gesetzgebungsverfahren mit Auswirkungen auf Städte und Gemeinden unbedingt Praktiker aus den Kommunalverwaltungen hinzugezogen werden sollten. Auch ein Praktikum für Ministerialbeamte in kommunalen Behörden könnte den Blick für die Sorgen und Nöte auf der untersten staatlichen Ebene schärfen. Der geschäftsführende Vorstand des Gemeinde- und Städtebunds zeigt auf, welche unbedachten Konsequenzen neue oder geänderte Bundesgesetze für die Kommunen haben. Wegen der steigenden Mieten wurde der Anspruch auf Wohngeld ausgeweitet, um soziale Härten zu vermeiden. Um die zusätzlichen Anträge zeitnah prüfen zu können, brauchten die wohngeldbearbeitenden Behörden der Landkreise und kreisfreien Städte dringend zusätzliches Personal, das zudem auf kommunaler Ebene finanziert werden musste.
Petry erkennt an, dass die Landesregierung das Problem der kommunalen Unterfinanzierung auf dem Schirm hat und nach Kräften versucht zu helfen. Rheinland-Pfalz erhält insgesamt etwa 4,8 Milliarden Euro aus dem Bundessondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität", wovon 60 Prozent (etwa 2,9 Milliarden Euro) an die kommunale Ebene gehen und 40 Prozent beim Land verbleiben. Zusätzlich ergänzt die Landesregierung den kommunalen Anteil des Sondervermögens um weitere 600 Millionen Euro aus Landesmitteln, um den kommunalen Investitionen zusätzlichen Schwung zu verleihen. Außerdem wird der kommunale Finanzausgleich (KFA) 2025 und 2026 um je 300 Millionen Euro zugunsten der Träger der Sozial- und Jugendhilfe angehoben.
„Damit wird durchaus ein positives Zeichen gesetzt. Aber es ist letztlich eine Defizitreduktion und keine Defizitbeseitigung“, sagt Petry. Die aktuellen Sozialausgaben der Kommunen in Rheinland-Pfalz belaufen sich auf 2,3 Milliarden Euro. „Die Schere geht immer weiter auseinander. Unser Sozialstaat muss diejenigen schützen, die Schutz brauchen. Das ist unbestritten. Aber wir müssen gleichzeitig auch auf unsere Wirtschaftskraft und das Leistbare schauen. Wir müssen deshalb Sozialleistungen zielgerichtet einsetzen und konsequent prüfen, ob Ansprüche tatsächlich bestehen oder nicht.“

Es ist fünf vor zwölf. Zahlreiche Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind verschuldet. Auch Zahlungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und zusätzlich bewilligte Mittel führen nur zu einer Schuldenverringerung, nicht aber zu einer dringend notwendigen Entschuldung.
Foto: Gina Sanders/stock.adobe.com
Die Talsohle der Schuldenfalle scheint trotz zusätzlicher Finanzspritzen des Landes noch nicht erreicht. Die Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene sind nach Erhebungen des Statistischen Landesamts im Vergleich der ersten Halbjahre 2024 und 2025 um mehr als 371 Millionen Euro beziehungsweise 5,1 Prozent auf gut 6,9 Milliarden Euro zurückgegangen. Allein die Zuflüsse aus Steuern als eine zentrale Einnahmequelle gingen um gut 68 Millionen Euro oder 2,7 Prozent zurück.
Großen Einfluss hatten die rückläufigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer (minus 131 Millionen Euro, das entspricht minus 9,1 Prozent) sowie aus der Grundsteuer (minus 41 Millionen Euro, das sind minus elf Prozent). Das frisst einen großen Teil der zusätzlichen Strukturhilfen durch das Land schon wieder auf.
„In den Ämtern und Behörden sitzen viele kluge Köpfe, denen man viel mehr zutrauen kann. Kommunen jagen nicht irgendwelchen Hirngespinsten hinterher, sondern wissen sehr wohl, wie man mit Geld klug und achtsam umgeht.“
Moritz Petry
„Wenn sich diese Entwicklung weiter verstetigt, wird auch die Investitionskurve der Kommunen weiter nach unten zeigen. Wir laufen der Entwicklung ständig hinterher, reparieren hier und dort, aber tun zu wenig für eine wirkliche Umkehr dieses Negativtrends“, sagt Petry. Er spricht sich für drei Sofortmaßnahmen aus, die nach seiner Auffassung schnelle Besserung bringen könnten. Er plädiert für einen höheren Anteil der Kommunen am Steueraufkommen des Bundes und des Landes, damit Altschulden abgetragen werden können. Förderprogramme sollten stärker projektbezogen konzipiert sein. Außerdem fordert er eine effiziente und ehrliche Entbürokratisierung. Sein Verband habe gerade erst 500 Vorschläge für durchgreifende Verwaltungsvereinfachungen unterbreitet, die in Teilen schon von der Landesregierung geprüft werden. Ein weiteres zentrales Anliegen ist für Petry die Stärkung des Vertrauens in die kommunale Selbstverwaltung. „In den Ämtern und Behörden sitzen viele kluge Köpfe, denen man viel mehr zutrauen kann. Kommunen jagen nicht irgendwelchen Hirngespinsten hinterher, sondern wissen sehr wohl, wie man mit Geld klug und achtsam umgeht.“
Zur Person

Moritz Petry, Jahrgang 1975, war nach seinem Magister-Abschluss in Politikwissenschaften an der Universität Trier Senior Consultant bei der Personalberatung Michael Page. Er wurde dann Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel (2010 bis 2014) und später der Verbandsgemeinde Südeifel (2014 bis 2024). Seit April 2024 ist Petry geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz.
Foto: GStB
Zum Verband
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ist der mitgliederstärkste kommunale Spitzenverband in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen der Gemeinden und Städte gegenüber Politik, Medien und Gesellschaft. Von den 2430 Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz gehören dem GStB 2417 Kommunen als Mitglieder an. Mit mehr als 3,1 Millionen Einwohnern repräsentieren sie die Mehrheit der Kommunen und Menschen in Rheinland-Pfalz (vier Millionen Einwohner). Der Verband begleitet für seine Mitglieder Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren in Rheinland-Pfalz mit Stellungnahmen bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen. Darüber hinaus erarbeitet er wichtige Empfehlungen für die Praxis, beispielsweise Mustersatzungen und Argumentationshilfen und berät in fachlichen und rechtlichen Fragestellungen.
Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben eines öffentlichen Haushalts (beispielsweise von Städten und Gemeinden) in einem bestimmten Zeitraum. Er zeigt an, ob ein Überschuss (positive Einnahmen, negative Ausgaben) oder ein Defizit (negative Einnahmen, positive Ausgaben) vorliegt. Der Finanzierungssaldo ist eine wichtige Kennzahl, um die finanzielle Lage und die Haushaltsführung zu beurteilen. Für die rheinland-pfälzischen Kommunen sieht die Lage besorgniserregend aus.

Grafik: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Hans-Rolf Goebel
Redakteur
Hans-Rolf Goebel ist seit 2018 als Freier Autor für die WIRTSCHAFT tätig. Der gelernte Journalist verantwortet die Beiträge für das Topthema als Aufmacher der Zeitung und für das Dossier.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



