Ihr Warenkorb ist leer
Menü
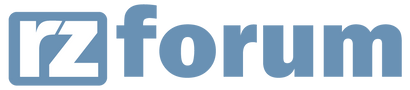
Stromteuerland - wie lange kann die Industrie das stemmen?
Oktober 31, 2025 11 min lesen.

Oberflächenveredeltes Aluminium wird bei Novelis mit einem sehr hohen Recyclinganteil hergestellt - und mit hohem Energiebedarf. Bei etwa 700 Grad wird Aluminiumschrott eingeschmolzen und für den nächsten Produktlebenszyklus vorbereitet. So entstehen Grundstoffe für viele Industrien und Technologien: für die Automobilindustrie, für die Getränkedosenfertigung und für die Luft- und Raumfahrt.
Foto: Novelis
Kostendruck
Deutsche Unternehmen zahlen für Industriestrom rund 17 Cent pro Kilowattstunde, das sind etwa 18 Prozent mehr als der europäische Durchschnitt. Im Vergleich zu den USA und China sind die Stromkosten sogar mehr als doppelt so hoch. Das schadet der Wettbewerbsfähigkeit und verhindert Investitionsentscheidungen.
Im Koblenzer Werk von Novelis wird an jedem Tag der Woche rund um die Uhr produziert. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminiumrecycling. Folker Ohle verantwortet als Senior Vice President Operations die Produktionsaktivitäten von zehn Standorten in Europa – auch die in Koblenz. „Weil unsere Produktionsanlagen 24/7 laufen, sind wir auf eine stabile und verlässliche Energieversorgung angewiesen. Wir haben in den vergangenen vier bis fünf Jahren eine erhebliche Steigerung der Produktionskosten erlebt, besonders bei Energie. Das ist ein schleichender, aber gefährlicher Prozess, denn wir verlieren dadurch sogar Marktanteile.“
Sein Kollege Roland Leder, Vice President Supply Chain bei Novelis Europe, der seine Konzernkarriere in Koblenz begann, pflichtet Ohle uneingeschränkt bei. „Der Wettbewerbsnachteil für energieintensive Unternehmen verschärft sich dramatisch. Nach den Arbeitskosten sind die Ausgaben für Strom und Gas mit einem Anteil von 25 Prozent unser größter Kostenblock.“
„Wir haben in den vergangenen vier bis fünf Jahren eine erhebliche Steigerung der Produktionskosten erlebt, besonders bei Energie. Das ist ein schleichender, aber gefährlicher Prozess, denn wir verlieren dadurch sogar Marktanteile.“
Folker Ohle, Senior Vice President Operations von Novelis Inc.
Hätte Novelis nicht schon vor 15 Jahren erkannt, wieviel Potenzial im Recycling von Aluminiumprodukten steckt, wären die überdurchschnittlich hohen Energiekosten vielleicht sogar existenzbedrohend für das Unternehmen geworden.
„Wir haben eine perfekte Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz herstellen können. Bei den Karosserieteilen für Autos liegt unser Recyclinganteil inzwischen bei 86 Prozent, bei Dosen sogar bei 95 Prozent“, sagt Ohle. Bei jeder Tonne recyceltem Aluminium beträgt die Energieeinsparung im Vergleich zur Verarbeitung von Primäraluminium etwa 95 Prozent.
Leder beklagt vor allem die Kurzlebigkeit politischer Entscheidungen. „Für uns ist neben einer Senkung der Energiekosten die Planungssicherheit von entscheidender Bedeutung.“ Als Beispiel nennt er das Hin und Her bei den staatlichen Zuschüssen zu den Netzentgelten. Die Subventionen wurden 2024 gestrichen, was zu höheren Kosten für Industrie und private Verbraucher führte. Die Bundesregierung hat unlängst allerdings einen neuen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro beschlossen, um die Netzentgelte für 2026 und gegebenenfalls die Folgejahre zu senken. Die Finanzierung soll über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) erfolgen.
Ganz gleich, mit welchem Unternehmen, ob groß, mittelgroß oder klein, man spricht, die Netzentgelte sind allen ein Dorn im Auge und werden als hauptursächlicher Preistreiber empfunden. „Die Bezuschussung ist im Prinzip zu begrüßen“, sagt Leder. Es werde trotzdem von der Politik immer wieder verkannt, wie lang der Planungshorizont vieler Unternehmen ist. „Wir müssen oft Investitionsentscheidungen für fünf oder zehn Jahre treffen. Da helfen uns politische Entscheidungen, die für ein oder zwei Jahre gelten sollen, nicht wirklich weiter.“
Nur wenige Kilometer weiter plagen Clarissa Odewald, seit Juli 2024 Vorstandsvorsitzende bei Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach, die gleichen Sorgen. Die weltweit größte Produktionsstätte dieser Art stellt jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen Verpackungsstahl für rund 400 Kunden in 80 Ländern her.

Der Thyssenkrupp Rasselstein-Standort in Andernach ist der weltweit größte für Verpackungsstahl. Der Hersteller ist einer der größten Arbeitgeber im nördlichen Rheinland-Pfalz und beliefert Kunden rund um den Globus, unter anderem Hersteller von Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Getränkedosen.
Foto: Thyssenkrupp Rasselstein
„Die hohen Energiekosten sind ein klarer Standortnachteil. Die Wettbewerbsfähigkeit wird dadurch stark belastet, die Preisunterschiede werden in unseren Margen sichtbar. Wir produzieren seit 1760 in Deutschland und sind einer der größten Arbeitgeber im nördlichen Rheinland-Pfalz. Aber die Rahmenbedingungen machen uns gegenwärtig das Leben nicht gerade leicht“, sagt Odewald. Sie verweist darauf, dass ihr Unternehmen in einer Art Zangenbewegung von zwei Seiten gleichzeitig unter Druck gerät. Produkte, vor allem aus China, würden mit Preisen für Strom von etwa acht Cent die Kilowattstunde hergestellt und dann massenhaft in den deutschen und europäischen Markt gepumpt.
„Es ist an der Zeit, dass wir den europäischen Binnenmarkt vor solchen Billigimporten besser schützen. Andere Länder reagieren oft viel schneller und entschiedener, während in der EU monate- manchmal jahrelang geprüft wird, ob zum Beispiel durch Dumpingpreise tatsächlich ein Schaden entstanden ist und man deshalb gegen den Urheber vorgehen muss“, sagt Odewald. Auch das Wettbewerbsgefälle für Industriestrom innerhalb Europas, zum Beispiel die atomkraftbedingten Niedrigpreise in Nachbarländern, wirken sich auf den Produktionsstandort Deutschland aus. Die USA haben wiederum Stahlprodukte aus Europa mit einem Zoll in Höhe von 50 Prozent belegt. Kein einfaches Wettbewerbsumfeld.
Horst Meierhofer, Geschäftsführer des Landesverbands Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz, glaubt, dass sich der politische Fokus mit Blick auf die Energieversorgung verschoben hat und begrüßt das. „Es ist wichtig, dass die Energiewende mit dem Ziel der CO2-Neutralität in Deutschland bis 2045 weiter vorangetrieben wird. Aber genauso wichtig ist es, diese Entwicklung nicht mehr so zu forcieren, dass das Gesamtsystem auf Dauer überfordert wird. Tempo rauszunehmen ist richtig.“
Meierhofer spricht von der Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance aus Preisgestaltung, Netzausbau und Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien. Die Herausforderungen seien groß. „Der Strombedarf wird stark ansteigen, nimmt man allein die E-Mobilität oder den Bau großer Rechenzentren wie im Rhein-Main-Gebiet. An regionale Verteilnetze werden völlig neue Ansprüche gestellt und die Finanzierung der Transformation rückt immer mehr ins Blickfeld.“ Durch die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr bieten sich aus seiner Sicht aber auch Chancen für die örtlichen Stadtwerke, da ihre Geschäftsfelder größer werden.
„Es ist wichtig, dass die Energiewende mit dem Ziel der CO2-Neutralität in Deutschland bis 2045 weiter vorangetrieben wird. Aber genauso wichtig ist es, diese Entwicklung nicht mehr so zu forcieren, dass das Gesamtsystem auf Dauer überfordert wird.“
Horst Meierhofer, Geschäftsführer des Landesverbands Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz
Auch Marcelo Peerenboom, Leiter der Stabsstelle Kommunikation bei der Energieversorgung Mittelrhein (EVM), sieht sein Unternehmen vor großen Anforderungen, für die es allerdings gut gerüstet sei. „Wir haben in Deutschland eine verlässliche, grundlastfähige Stromversorgung mit einer hohen Versorgungssicherheit. Dass jetzt wichtige Justierungen vorgenommen werden, beispielsweise um den Ausbau von Photovoltaik besser steuern zu können, ist eine vernünftige Maßnahme.“ Das Überangebot aus der dezentralen Einspeisung vieler kleiner Stromerzeuger habe in der Vergangenheit immer wieder zu absurden Situationen geführt. Die Strombörse verzeichnete sogenannte negative Strompreise, das heißt, Kunden bekamen Geld dafür, dass sie Strom abnehmen.
Dass neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen, hält Peerenboom für richtig. Die Gasbrücke sei eine wichtige Maßnahme zur Erreichung der Energiewende. „Damit erhalten wir eine viel größere Flexibilität. Gaskraftwerke kann man, anders als Kohlekraftwerke, kurzfristig und bedarfsgerecht zuschalten. Sie schließen so die Lücke zwischen der Energieerzeugung durch Erneuerbare und dem Gesamtverbrauch.“ Das gelte zum Beispiel für sogenannte „Dunkelflauten“, also wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht.
„Wir haben in Deutschland eine verlässliche, grundlastfähige Stromversorgung mit einer hohen Versorgungssicherheit. Dass jetzt wichtige Justierungen vorgenommen werden, beispielsweise um den Ausbau von Photovoltaik besser steuern zu können, ist eine vernünftige Maßnahme.“
Marcelo Peerenboom, Leiter der Stabsstelle Kommunikation bei der Energieversorgung Mittelrhein (EVM)
Der Weg zum Ausbau der erneuerbaren Energien wird von der EVM konsequent weiterverfolgt. Der Erzeugungsanteil liegt bundesweit derzeit bei 58 Prozent. Das Ziel lautet: 80 Prozent bis zum Jahr 2035. Peerenboom glaubt, dass Rheinland-Pfalz beim deutschlandweiten Ranking der erneuerbaren Energien bald einen großen Schritt nach vorne machen wird. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau eines leistungsstarken Windkraftparks auf der Schneifelhöhe bei Prüm begonnen werden. Ähnliche Windkraftparks sind bei Neuwied und auf der Lahnhöhe in Planung. Das Investitionsvolumen liegt jeweils bei einem Betrag in dreistelliger Millionenhöhe. Einen Seitenhieb auf die lähmende Bürokratie in Deutschland kann sich Peerenboom dann doch nicht verkneifen. „Es ist kaum vermittelbar, dass das Genehmigungsverfahren für das Projekt Schneifelhöhe von der Antragstellung bis zum Baubeginn zehn Jahre gedauert hat.“
Den Weg, durch Eigeninitiativen im Wege der Stromerzeugung oder -einsparung die Kostenlast zu senken, beschreiten sowohl Novelis als auch Thyssenkrupp Rasselstein. Novelis setzt dabei auf erneuerbare Energien wie etwa Photovoltaik, Batteriespeicher und Wasserstofftechnologie. Die Produktion wird permanent auf Energieeinsparpotenziale überprüft. Das hat in Europa bereits zu einer jährlichen Reduktion der Energieintensität um zwei Prozent geführt. Thyssenkrupp Rasselstein deckt den Energiebedarf zu gut 15 Prozent durch Kraft-Wärme-Kopplung und bezieht diesen Strom außerdem vom Industrieheizkraftwerk Andernach − ein Ersatzbrennstoffkraftwerk zur thermischen Abfallverwertung. Auch bei Thyssenkrupp Rasselstein ist eine PV-Anlage in Planung, die als ergänzender Baustein bei der Abdeckung des Energiebedarfs helfen soll.
„Die hohen Energiekosten sind ein klarer Standortnachteil. Die Wettbewerbsfähigkeit wird dadurch stark belastet, die Preisunterschiede werden in unseren Margen sichtbar.“
Clarissa Odewald, Vorstandsvorsitzende bei Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach
Zukunftsmusik ist für beide Unternehmen bisher noch der verstärkte Einsatz von Wasserstoff als Energieträger, der die Verwendung von Gas ersetzen soll. „Oberste Priorität hat eine ausreichende, stabile Energieversorgung. Noch ist nicht klar, in welcher Menge und zu welchem wettbewerbsfähigen Preis Wasserstoff als Energieträger der Zukunft zur Verfügung stehen wird,“ sagt Clarissa Odewald. Aber man ist der Entwicklung bei Thyssenkrupp Rasselstein mit zwei eigenen Forschungsprojekten auf der Spur.
Ohle von Novelis sieht beim Einsatz von Wasserstoff in der Produktion noch viele Fragezeichen. „Wir haben das Ganze in England bereits simuliert und Teile der Recyclinganlage im Pilotprojekt auf Wasserstoff umgestellt. Das entspricht einer Einsparung von bis zu 90 Prozent CO2-Emissionen gegenüber Gasbetrieb. Technisch funktioniert das, betriebswirtschaftlich nicht. Die Kosten waren letztlich um ein Vielfaches höher als bei einer gasbetriebenen Anlage.“
Die EVM-Gruppe rüstet sich für eine Wasserstoff-Zukunft. Für das Industriegebiet Koblenz-Kesselheim wird derzeit in enger Abstimmung mit den örtlichen Unternehmen ein Pilotprojekt für den Ersatz des Gasnetzes durch ein Wasserstoffnetz durchgespielt. Im Mittelpunkt stehen sowohl die technische als auch die kaufmännische Machbarkeit. Geplante Transformationsphase – 2032 bis 2045.
„Wir müssen oft Investitionsentscheidungen für fünf oder zehn Jahre treffen. Da helfen uns politische Entscheidungen, die für ein oder zwei Jahre gelten sollen, nicht wirklich weiter.“
Roland Leder, Vice President Supply Chain bei Novelis Europe
Zu den Personen

Folker Ohle ist seit 2019 bei Novelis und verantwortet als Senior Vice President Operations die Produktionsaktivitäten von zehn Standorten in Europa. Er bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Fertigung und Engineering mit. Ohle hat einen Abschluss in Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre der TU Berlin und der TH Darmstadt.
Foto: Novelis

Roland Leder ist Vice President Supply Chain bei Novelis Europe. Seine Karriere begann er am Koblenzer Novelis-Standort, bevor ihn internationale Führungsaufgaben in die USA führten. Heute verantwortet er die europäische Lieferkette für die Aluminiumwalzprodukte und das Recycling. Leder engagiert sich auch für die Interessen seiner Industrie – er war unter anderem Präsident der Wirtschaftsvereinigung Metalle (WVM), mit starkem Fokus auf Energie- und Klimapolitik.
Foto: Novelis

Clarissa Odewald begann nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau und Diplomkauffrau 2007 als Trainee bei der Thyssenkrupp Steel Europe AG in Duisburg. Schnell stieg sie im Konzern auf und übernahm Führungsaufgaben in den Bereichen Einkauf und Vertrieb. 2021 wechselte sie als Head of Sales Overseas zu Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach
und wurde dort im Juli 2024 Vorstandsvorsitzende.
Foto: Thyssenkrupp Rasselstein

Horst Meierhofer ist Geschäftsführer des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW). Der Verband vertritt rund 270 Mitglieder aus den Sparten Strom, Erdgas und Fernwärme sowie Wasser und Abwasser. Gegründet wurde er im Jahr 2002 als Zusammenschluss der Verbände für Gas und Wasser sowie für Elektrizität.
Fotos: LDEW

Marcelo Peerenboom ist seit neun Jahren für die Unternehmenskommunikation der EVM-Gruppe verantwortlich. Nach seinem Volkswirtschaftsstudium war er lange Jahre als Journalist tätig, zuletzt als Leiter einer Regionalredaktion. Nach 25 Jahren führte ihn sein Weg zur EVM, wo er ein Team von zehn Personen leitet, das die interne und externe Kommunikation betreut.
Foto: EVM
Zu den Unternehmen
-
Name: Novelis Inc.
Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, der Metallsparte der Aditya Birla Group, Mumbai, Indien. - Gegründet: 2005
- Kernkompetenz: Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten unter anderem für die Automobilindustrie, die Getränkedosenfertigung und die Luftfahrt
- Standorte: Koblenz, außerdem Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
- Mitarbeitende: etwa 13.000 weltweit
- Umsatz: 17,1 Milliarden US-Dollar Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025
- Weitere Informationen:www.novelis.com
- Name: Thyssenkrupp Rasselstein GmbH
- Gegründet: 1760
- Kernkompetenz: Anbieter von Verpackungsstahl für Hersteller von Lebensmittel und Tiernahrungsdosen, Aerosoldosen, Behältern für chemisch-technische Füllgüter sowie von Kronkorken und Drehverschlüssen.
- Standort: Andernach
- Mitarbeitende: rund 2400
- Weitere Informationen:www.thyssenkrupp-steel.com
- Name: EVM (Energieversorgung Mittelrhein)
- Gegründet: 2014 nach Zusammenschluss von Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs- Aktiengesellschaft und Gasversorgung Westerwald GmbH
- Kernkompetenz: Versorgung ihrer Kunden mit Strom, Erdgas, Wärme, Trinkwasser, Telekommunikation
- Standorte: Zwei Hauptstandorte in Koblenz, 14 Kundenzentren in der Region
- Mitarbeitende: rund 1000
- Weitere Informationen:www.evm.de
Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien sind sauber, sie vermeiden Treibhausgase und Schadstoffe und vermindern dadurch den Treibhausgaseffekt und Gesundheitsbelastungen. Auch ökonomisch gibt es viele Gründe für die Erneuerbaren: So sind Sonne, Wind und Biomasse, Erdwärme und Wasser heimische Energieträger, durch deren Nutzung teure fossile Brennstoffimporte eingespart werden können. Von 2012 bis 2024 ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland auf 285 Milliarden Kilowattstunden gestiegen und hat sich damit ungefähr verdoppelt.
Wind
Die Windenergie leistet in Deutschland den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Die Nutzung des Windes als Antriebsenergie hat eine lange Tradition. Windmühlen wurden zum Mahlen von Getreide oder als Säge- und Ölmühlen eingesetzt. Moderne Windenergieanlagen nutzen den Auftrieb, den der Wind beim Vorbeiströmen an den Rotorblättern erzeugt. Die Stromerzeugung aus Windenergie hat innerhalb weniger Jahre stark zugenommen. Vor allem der Austausch älterer Anlagen durch moderne, leistungsfähigere ("Repowering") und die Windenergienutzung auf dem Meer ("Offshore") bieten Perspektiven für den weiteren Ausbau.
Sonne
Die Sonne steht als Energiequelle unbegrenzt, umweltfreundlich und kostenlos zur Verfügung. Aus dem Sonnenlicht können Strom und Wärme gewonnen werden. Daneben sind die solare Kühlung und Prozesswärme innovative Einsatzbereiche der Sonnenenergie, die an Bedeutung gewinnen. Die Strahlungsenergie, die die Erde von der Sonne innerhalb von 90 Minuten empfängt, entspricht etwa dem Weltenergieverbrauch eines ganzen Jahres.
Biomasse
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie in Form von Energiepflanzen, Holz oder Reststoffen wie etwa Stroh, Biomüll oder Gülle. Bioenergie ist unter den Erneuerbaren Energieträgern der "Alleskönner": Sowohl Strom, Wärme als auch Treibstoffe können aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse gewonnen werden.
Erd- und Umweltwärme
Geothermie (Erdwärme) ist die Wärmeenergie, die unterhalb der festen Oberfläche der Erde gespeichert ist. Mittels Geothermie wird also Erdwärme genutzt, um Strom, Wärme und Kälteenergie zu gewinnen. Man unterscheidet die oberflächennahe Nutzung der Erd- beziehungsweise Umgebungswärme und die Tiefengeothermie. Die im Erdinneren herrschenden Temperaturen von bis zu 6000 Grad Celsius erwärmen die oberen Gesteins- und Erdschichten sowie unterirdische Wasserreservoirs. In Mitteleuropa nimmt die Temperatur im Schnitt um rund 3 Grad Celsius pro 100 Meter Tiefe zu. Um für die Stromerzeugung und den Betrieb von Fernwärmenetzen ausreichend hohe Temperaturen zu erreichen, muss entsprechend tief gebohrt werden. Die Mühe lohnt sich, denn einmal angezapft, steht die Erdwärme unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeit zur Verfügung.
Wasserkraft
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt. In Deutschland war sie lange Zeit die bedeutendste regenerative Energiequelle, bis sie 2004 von der Windenergie überholt wurde. Heute ist die Wasserkraft eine ausgereifte Technologie und stellt weltweit knapp die Hälfte der erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten. Sie steht rund um die Uhr zur Verfügung und kann auch als Energiespeicher genutzt werden.
Quelle und Grafik: Agentur für Erneuerbare Energien e. V.
Stromnetzausbau

Foto: IrfanAhmad/stock.adobe.com
Der Stromnetzausbau in Deutschland ist ein Kernprojekt der Energiewende, um den steigenden Strombedarf zu decken und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien wie Windkraft im Norden, deren Strom in die Verbrauchszentren im Süden transportiert werden muss. Aktuelle Pläne umfassen rund 16.800 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen, wobei sich der Fortschritt bei den Genehmigungen und Bauvorhaben 2024 beschleunigt hat. Ende 2024 wurden für 4529 Kilometer die Genehmigung erteilt. Sie stehen vor dem Baubeginn oder sind im Bau. Bis Ende 2025 sollen rund 4400 Kilometer fertiggestellt sein. Der Investitionsbedarf ist beträchtlich. Schätzungen gehen von rund 323 Milliarden Euro bis 2045 aus, um die Ziele der Energiewende zu erreichen.
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
Lagebewertung zur Gasversorgung

Aus diesen Ländern wurde Gas importiert.
Deutschland hat im Jahr 2024 nach vorläufigen Zahlen insgesamt 865 Terawattstunden Erdgas importiert (2023: 968 TWh). Die größten Mengen kamen aus Norwegen (48 Prozent), den Niederlanden (25 Prozent) und Belgien (18 Prozent).
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht regelmäßig einen Lagebericht zur Einschätzung der aktuellen Gasversorgung. Gegenwärtig schätzt sie die Versorgungssicherheit mit Gas wie folgt ein:
„Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat die seit dem 23. Juni 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans Gas in Deutschland aufgehoben. Seit dem 1. Juli 2025 gilt wieder die Frühwarnstufe. Die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage genau und steht in engem Kontakt zu den Netzbetreibern. Die Bundesnetzagentur beobachtet weiterhin aufmerksam die internationalen Entwicklungen am Gasmarkt. Das Ende des Gastransits durch die Ukraine hat keine direkten Auswirkungen auf die deutsche Gasversorgung. Aufgrund des eingestellten Gastransits durch die Ukraine haben die Durchleitungen der Gasflüsse durch Deutschland zugenommen. Deutschland verfügt, auch dank der verfügbaren Kapazitäten an den LNG-Terminals, über ausreichend Transport-Kapazitäten für Exporte nach Südosteuropa. Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick als gering ein. Ein sparsamer Gasverbrauch bleibt dennoch wichtig.“
Quelle und Grafik: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Hans-Rolf Goebel
Redakteur
Hans-Rolf Goebel ist seit 2018 als Freier Autor für die WIRTSCHAFT tätig. Der gelernte Journalist verantwortet die Beiträge für das Topthema als Aufmacher der Zeitung und für das Dossier.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



