Ihr Warenkorb ist leer
Menü
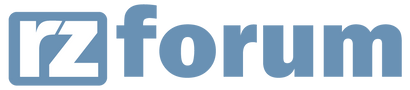
Zu teuer, zu ineffizient
Oktober 31, 2025 4 min lesen.

Experten mahnen zu mehr Ehrlichkeit in der Leitungsfähigkeit des Sozialstaats. Denn die jetzigen Sozialleistungen sind auf Dauer nicht finanzierbar und stellen die künftigen Generationen vor große Probleme.
Foto: Bussarin/stock-adobe.com
Systemschwäche
Unser Sozialstaat ist in hohem Maße reformbedürftig. Fehlt der Mut für ein tiefgreifendes Umdenken, werden die Sozialversicherungen in eine immer dramatischere Schieflage geraten.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, besser bekannt als die sogenannten „Wirtschaftsweisen“, hat in der jüngeren Vergangenheit nicht nur mit seinen Gutachten zur konjunkturellen Lage Deutschlands und mit Wirtschaftsprognosen Aufsehen erregt. Vielmehr gab es immer wieder Berichte über interne Querelen und Zwistigkeiten unter den fünf Experten, die der Bundespräsident nach Vorschlag durch die Bundesregierung ernennt. Umso bemerkenswerter hält Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemie-Pumpen GmbH in Ransbach-Baumbach und Vorsitzender des VDMA (Verband des Maschinen- und Anlagenbaus)-Landesverbands Mitte, die Einigkeit unter den Sachverständigen, wenn es um die Einschätzung der Fehlentwicklungen in unserem Sozialstaat geht.
„Es herrscht in diesem Gremium offenbar Konsens, dass der Sozialstaat an seine Grenzen stößt, dass er nicht mehr bezahlbar ist, und wir zu Lasten der nächsten Generationen leben.“ Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Prof. Dr. Monika Schnitzer, fand deutliche Worte. Sie hält einen Kollaps des Sozialsystems für unausweichlich, wenn die wesentlichen Säulen des Sozialstaats, die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, von der Bundesregierung nicht grundlegend reformiert werden. Die Sozialversicherungen seien schlicht nicht zukunftsfest.
„Bürger und Unternehmen haben eine Erwartungshaltung eingenommen, die sich immer mehr von Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung wegentwickelt hat. Das Motto lautet: Der Staat soll es richten.“
Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemie-Pumpen GmbH in Ransbach-Baumbach und Vorsitzender des VDMA-Landesverbandes Mitte
Prof. Dr. Veronika Grimm, ebenfalls Wirtschaftsweise, schließt sich dieser Einschätzung nahtlos an, hält angesichts der angespannten finanziellen Lage der Sozialversicherungen auch Leistungskürzungen für nötig und mahnt mehr Ehrlichkeit in der Diskussion über die Leitungsfähigkeit des Sozialstaats an.
Munsch sagt: “Unser Staat ist ein Abbild der Gesellschaft. Bürger und Unternehmen haben eine Erwartungshaltung eingenommen, die sich immer mehr von Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung wegentwickelt hat. Das Motto lautet: Der Staat soll es richten.“ Der Unternehmer sieht vor allem zwei Gründe, warum das Sozialsystem unaufhaltsam in die Krise gerutscht ist. „Es sind zum einen viel zu lange die schwerwiegenden Auswirkungen des Demographie-Faktors ausgeblendet worden. Und wir haben seit Jahren keine nennenswerte Produktivitätssteigerung zustande gebracht. Wäre das gelungen, hätte die Wirtschaft die kontinuierliche Ausweitung des Sozialstaats in Teilen auffangen können.“
Munsch nennt dieses Phänomen eine sich selbst verstärkende, immer schneller drehende Abwärtsspirale. Diese Entwicklung könne nur mit mutigen Reformen gestoppt werden. Die Abwärtsspirale sei nach seiner Auffassung die Folge einer Kausalkette. Die Konsequenzen eines Sozialstaats ohne Reformen lägen auf der Hand: Schon heute fließen rund 42 Prozent des Bruttoeinkommens in die Sozialkassen. Bald könnten es nach Einschätzung der Wirtschaftsforschung gut 50 Prozent werden. Das drückt auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen und deren Investitionsbereitschaft. Als Folge steigt die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosen- und Rentenversicherung brauchen mehr Geld, das wiederum bei Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung fehlt.
Auch zum Thema Rente hat der Unternehmer aus Ransbach-Baumbach eine dezidierte Meinung. „Als ich in den 1980er Jahren an der TU Darmstadt studierte, hatte dort Prof. Rürup den Lehrstuhl für Finanz- und Wirtschaftspolitik inne. Er hat schon damals zu mir gesagt: ‘Wenn Ihre Generation aus dem Erwerbsleben ausscheidet, wird das umlagefinanzierte Rentensystem nicht mehr ausreichen‘.“
Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit hält Munsch für unumgänglich. Die Rente mit 63 und die Vorruhestandsregelungen vieler Unternehmen sind in seinen Augen Fehler, weil sie das Sozialsystem überfordern und zudem den Fachkräftemangel beschleunigen. Auch vom Modell der Mütterente hält Munsch nicht viel. Vom schwedischen Rentensystem könne man sich in Deutschland durchaus etwas abschauen. Es kombiniert ein Umlageverfahren mit einer kapitalgedeckten Aktienrente, der sogenannten Prämienrente. 16 Prozent der Einkommen fließen in die umlagefinanzierte Rente, während 2,5 Prozent als Prämienrente in Aktienfonds investiert werden. Die Versicherten können zwischen privaten Fonds oder einem staatlichen Fonds wählen. Der Kapitalertrag kommt dann der individuellen Rente zugute.
Munsch hat kürzlich selbst die schmerzliche Erfahrung gemacht, welche negativen Auswirkungen der Reformstau in Deutschland mit sich bringt. Ein sehr fähiger und verdienter Mitarbeiter hat ihm angekündigt, dass er das Unternehmen verlassen werde, um mit seiner Familie auszuwandern. Seine Begründung: In Deutschland herrsche vor allem Stillstand, Bürokratie und Ankündigungspolitik. Davon habe er schlicht und einfach genug.
Sozialausgaben des Staates
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass sich die Pro-Kopf-Sozialausgaben des Bundes in Deutschland innerhalb von 30 Jahren nahezu verdoppelt haben. In der IW-Studie werden sämtliche Bundeshaushalte ab 1992 verglichen. Inflationsbereinigt zahlte im Jahr 1992 jeder Bürger 1464 Euro für Soziales, 2024 waren es 2665 Euro.
Allein die Ausgaben für die Sozialversicherungen haben sich pro Kopf mehr als verdoppelt (von 755 Euro auf 1644 Euro). Für den Arbeitsmarkt (zum Beispiel Bürgergeld) haben sie sich sogar verdreifacht – von 187 Euro auf 625 Euro. Steuerfinanzierte Zuschüsse zur Rente machen heute rund ein Viertel der Bundesausgaben aus. Hinzu kommen rund elf Prozent für das Bürgergeld und andere Maßnahmen, gut drei Prozent für die Krankenversicherung sowie zehn Prozent für sonstige Sozialleistungen. Insgesamt fließt damit heute gut jeder zweite Bundeseuro ins Sozialbudget.
Im gleichen Zeitraum sind die Investitionen deutlich zurückgegangen. 1992 lag ihr Anteil am Gesamthaushalt des Bundes noch bei mehr als 15 Prozent. 2011 fiel er auf einen Tiefpunkt von neun Prozent. Aufgrund der Ausgaben während der Coronapandemie und des Sondervermögens stiegen die Investitionen zuletzt wieder auf 12,2 Prozent.
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Zur Person

Stefan Munsch wurde 1960 in Selters geboren. Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau und Elektrotechnik an der Fachhochschule Koblenz und der Technischen Universität Darmstadt. Von 1988 bis 1993 war Munsch Projektingenieur auf dem Gebiet Großanlagenbau beim Unternehmen Lurgi in Frankfurt am Main. Seit 1993 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Firmen Munsch Chemiepumpen und Munsch Kunststoffschweißtechnik.
Foto: Hans-Rolf Goebel
Zum Unternehmen
- Name: Munsch Chemie-Pumpen GmbH und Munsch Kunststoffschweißtechnik GmbH
Gegründet: 1964 von Erich Munsch - Geschäftsführung: Stefan Munsch
- Standort: Stammsitz Ransbach-Baumbach
- Kernkompetenz: Hersteller von Kunststoffpumpen zur Förderung von aggressiven, abrasiven, chemisch belasteten Flüssigkeiten und Flüssigkeitsgemischen.
- Mitarbeitende: rund 160
- Umsatz: Durch den Bau von 2200 Pumpen sowie 900 Kunststoffschweißgeräten betrug der Gesamtumsatz 2024 etwa 40 Millionen Euro
- Weitere Informationen: www.munsch.de
Hans-Rolf Goebel
Redakteur
Hans-Rolf Goebel ist seit 2018 als Freier Autor für die WIRTSCHAFT tätig. Der gelernte Journalist verantwortet die Beiträge für das Topthema als Aufmacher der Zeitung und für das Dossier.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



