Ihr Warenkorb ist leer
Menü
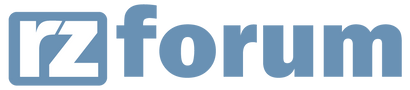
Nachhaltigkeit gegen Wirtschaftskraft?
Mai 12, 2025 6 min lesen.

Worum geht's?
Ist Klimaschutz ein Risiko für die Wirtschaft oder längst ihr treibender Motor? In diesem Beitrag beleuchtet Hans-Rolf Goebel den Spannungsbogen zwischen Wirtschaftskraft und ökologischer Verantwortung. Während etwa die USA mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und einer Rückkehr zu fossilen Energien einen Rückschritt machen, zeigen deutsche Unternehmen wie die Classen Gruppe, dass Nachhaltigkeit in Unternehmen zur treibenden Kraft werden kann – wenn die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen stimmen.
Julie Quervel von Classen plädiert für weniger Bürokratie und mehr Planungssicherheit: Investitionen in Klimaschutz und erneuerbare Energien lohnen sich, sofern sie nicht von Hürden gebremst werden. Die EVM betont: Nicht Klimaschutz, sondern der Klimawandel ist der wahre Wirtschaftskiller – und setzt auf Investitionen in Digitalisierung, Smart Grids und Nahwärme.
Auch nachhaltiges Bauen spielt eine Schlüsselrolle. Architekt Herbert Hofer fordert einen Perspektivwechsel in der Bauwirtschaft: Statt Abriss und Neubau solle auf langlebige, wiederverwertbare Bauweisen wie Lehm oder Stroh gesetzt werden. Mit dem Konzept des „kreativen Unterlassens“ soll der Wandel beschleunigt werden. Fazit: Transformation, ja – aber gemeinsam und mit Weitblick.
Zukunft Ist der Klimaschutz ein Wirtschaftskiller? Driften Ökologie und Ökonomie immer weiter auseinander oder setzt sich die Einsicht durch, dass der effektive Schutz der Umwelt nur mit der Wirtschaft geht und nicht gegen sie?
Mit verlässlicher Unberechenbarkeit erschütterte der amerikanische Präsident Donald Trump die internationalen Märkte durch seine aggressive Zollpolitik. Ähnlich radikal im Denken unterschrieb er gleich nach seinem Amtsantritt mehrere Dekrete, mit denen er eine grundlegende Kehrtwende in der Klimaund Energiepolitik einleitete. Er rief den nationalen Energienotstand aus und setzt wieder auf die Förderung fossiler Energien wie Gas und Erdöl. Zudem steigen die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zur Begrenzung der Erderwärmung aus, Zahlungen für klimaschützende Maßnahmen aus dem Inflation Reduction Act (IRA) und der Bau von Offshoreanlagen sowie neuen Windparks an Land sind gestoppt.
„Das ist der falsche Weg“, meint Julie Quervel, verantwortlich für Nachhaltigkeit bei der Classen Gruppe mit Sitz in Kaisersesch. Die Enkelin des Firmengründers Dr. Hans-Jürgen Hannig, der 1962 mit der Herstellung von Wandund Bodenbelägen sowie Türen und Zargen begann, ist der festen Überzeugung, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen können und müssen. „Klimaschutzförderungen müssen parallel zu Innovationsförderungen laufen, denn beides ist untrennbar miteinander verbunden“, sagt Quervel. „Im Gegensatz zu börsennotierten Unternehmen, die oft auf kurzfristige Gewinne fokussiert sind, verfolgen wir als Familienunternehmen eher einen langfristigen Ansatz. Aber dafür brauchen wir mehr Planungssicherheit.“
Für die Classen Gruppe sei nicht das sofortige Payback auf Investitionen wichtig. Investiert werde gezielt in Innovationen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte auszahlen. Diese stünden fast immer in engem Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz. Nachhaltigkeit sei für ihren Großvater schon ein entscheidender Wert gewesen, bevor der Begriff in aller Munde war, sagt Quervel. Sie nennt Beispiele: „Wir gehören mit unserer Produktion zu den energieintensiven Unternehmen, die sehr unter den hohen Strompreisen leiden. Wir betreiben hier am Standort Kaisersesch deswegen ein eigenes Biomassekraftwerk, seit drei Jahren nun auch zwei große PV-Anlagen und planen derzeit einen eigenen Windpark. All das trägt dazu bei, dass wir unser Stromkostenniveau senken können und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“
Als viel größere Gefahr für Wohlstand und Wachstum hat Quervel die überbordende Regulatorik ausgemacht. „Nachhaltigkeit darf kein bürokratischer Albtraum sein, sondern sie muss ein kalkulatorischer Vorteil werden. Unternehmen investieren in Klimaschutz, wenn es sich rechnet. Doch wenn Bürokratie jede sinnvolle Maßnahme verzögert oder bestraft, wird nachhaltiges Wirtschaften zur Belastung statt zur Chance.“ Sie ist davon überzeugt, dass ein Wandel für mehr Nachhaltigkeit viel schneller vollzogen werden könnte, wenn bürokratische Hürden wie doppelte und dreifache Berichtspflichten, Statistiken und schleppende Genehmigungsverfahren ihn nicht immer wieder ausbremsen würden. Die EVM (Energieversorgung Mittelrhein) sorgt sich ebenfalls um Entschiedenheit und Tempo bei der klimaschützenden Energiewende. Marcelo Peerenboom, Leiter der Stabsstelle Kommunikation, stellt klar: „Nicht der Klimaschutz ist der Wirtschaftskiller, sondern der Klimawandel. Flutkatastrophen wie an der Ahr, Stürme, Dürreperioden und die mit all dem verbundene Kostensteigerungen oder Produktionsausfälle haben massive wirtschaftliche Auswirkungen.“
Er sieht einen breiten Konsens in der deutschen Wirtschaft, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel ohne Alternative sind. „Diese Maßnahmen müssen mit Bedacht gewählt werden und finanzierbar sein. Aber wenn wir nicht an einem Strang ziehen, werden die Folgen für die Wirtschaft immer gravierender.“
Auch Hubertus Hacke, Leiter der Stabsstelle Energiepolitik und kommunale Projekte der EVM, sieht keinen Sinn darin, den Klimaschutz gegen die Wirtschaftskraft auszuspielen. Richtig sei, dass die Rahmenbedingungen für die Energiewende in Deutschland immer noch schwierig sind. „Das derzeitige Strommarktsystem ist noch zu stark auf die alte Welt ausgerichtet und nutzt die Vorteile erneuerbarer Energien nicht ausreichend“, sagt Hacke. Als Beispiel nennt er das sogenannte Merit-Order-Prinzip (Reihenfolge nach Vorteilhaftigkeit) bei der Preisbildung im Strommarkt. Die günstigsten Kraftwerke werden zuerst genutzt, also die erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarstrom. Aber das am Ende teuerste Kraftwerk, in der Regel Gas, bestimmt den Preis für alle anderen Kraftwerke und treibt ihn in die Höhe. Modelle wie Power Purchase Agreements (PPAs), also Direktverträge von Unternehmen mit Windparks oder PVFreiflächen, lockern nach Auffassung von Hacke den Markt bereits auf. Solche Nutzungsverträge für Windpark- und PV-Flächen werden zwischen dem Stromlieferanten und dem Stromabnehmer für mindestens 20 Jahre abgeschlossen. Der Betreiber der Erzeugungsflächen kann den Strom so direkt an einen Abnehmer liefern. Der erhält seinen Strom auf einer gesicherten Basis, und der Investor muss sich wegen der Langfristigkeit der Vertragsbindung keine Sorgen um seine Finanzierung machen.
Peerenboom verweist darauf, dass Nachhaltigkeit für die EVM kein Phänomen der jüngeren Zeit ist. Seit 2014 beliefert der Energieversorger seine privaten und gewerblichen Kunden ausschließlich mit Ökostrom. Aber bis etwa 2040 türmt sich noch ein großer Berg an Herausforderungen vor der EVM auf. In den kommenden 15 Jahren will die EVM dreistellige Millionenbeträge investieren, um die aktuelle Kapazität der Stromerzeugung um das Siebenfache zu erhöhen. Mit einer umfassenden Digitalisierung werden die Stromnetze auf dem Weg zum „Smart Grid“ fit gemacht, denn wegen der ständig steigenden Zahl an Einzelquellen, die Strom einspeisen, wird es immer schwieriger, das Stromnetz stabil zu halten. Und auch am Ausbau von Nahwärmenetzen beteiligt sich der Energieversorger aus Koblenz. Vom angekündigten Infrastrukturpaket der neuen Bundesregierung erhofft sich die EVM verlässlichere Rahmenbedingungen und mehr Beständigkeit. „Der Staat muss mitspielen, damit Energie bezahlbar bleibt“, sagt Peerenboom.
Eine weitere Branche, in der ein spürbarer Transformationsprozess stattfindet, ist die Bauwirtschaft. Herbert Hofer ist als Architekt Experte für nachhaltiges Bauen und Vorstandsmitglied der Architektenkammer Rheinland- Pfalz. Er sagt: „Leider werden die beiden Themen Wirtschaftskraft und Klimaschutz zu oft kontrovers gegenübergestellt. Es wäre viel zielführender, die beiden Themen miteinander zu denken. Politisch sind über die Jahre Fehler gemacht worden. Ein sinnvoller Wandel wurde in Deutschland weitgehend verschlafen.“ Das nachhaltige Bauen könne in der Vielfalt seiner Möglichkeiten sogar zum Wirtschaftsbooster werden, glaubt Hofer. Er plädiert dafür, das Augenmerk künftig stärker auf die Lebenszyklen von Bauwerken zu legen. Es sei eine bauliche Sünde, Gebäude zu errichten, die nach 20 oder 30 Jahren wieder abgerissen werden. Hofer erzählt, dass er bei Vorträgen oder Vorlesungen gern das Bild eines Fachwerkhauses zeige und dann die Zuhörer raten lasse, wie alt es sei. „Meistens liegen die Schätzungen bei 200 bis 400 Jahren. In der Tat ist das Haus, das ich zeige, 700 Jahre alt und es ist immer noch bewohnt.“
Manchmal lohne sich der Blick zurück. Damals wurden Kriterien angelegt, von denen modernes Bauen wieder lernen kann, zum Beispiel eine möglichst wertige Grundsubstanz zu nutzen, die auf ein langes Überdauern angelegt ist. Wichtig für einen neuen Ansatz im Bauwesen ist nach Ansicht von Hofer vor allem, nicht nur in der Kategorie Neubau zu denken, sondern bestehende Bausubstanz zu erhalten, umzuwidmen, neu zu nutzen oder so zu zerlegen, dass Bauteile und -stoffe sinnvoll wiederverwertet werden können. Der Bund deutscher Architekten (BDA) hat dazu das Motto „kreatives Unterlassen“ ausgegeben.
Nach Hofers Auffassung verdienen auch althergebrachte Bautechniken wieder eine neue Chance. „Pioniere in Frankreich, Österreich, der Schweiz, Italien, aber auch hier in Deutschland, befassen sich beispielsweise mit der Strohballenbauweise mit strohgedämmten Holzkonstruktionen und der Renaissance von Lehm als Baustoff.“ Was heute noch als experimentelles Bauen bezeichnet wird, könnte nach einer intensiven Förderung und mit neuen Kooperationen, beispielsweise zwischen Bauwirtschaft und Landwirtschaft, zu einem eigenen Wirtschaftszweig heranreifen. Ähnlich wie in der ökologischen Landwirtschaft sei es denkbar, so Hofer, Unternehmen, die bisher konventionelle Baustoffe hergestellt haben, bei der Umstellung auf die Produktion ökologischer Baustoffe zu unterstützen.
Hans-Rolf Goebel
Redakteur
Hans-Rolf Goebel ist seit 2018 als Freier Autor für die WIRTSCHAFT tätig. Der gelernte Journalist verantwortet die Beiträge für das Topthema als Aufmacher der Zeitung und für das Dossier.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



