Ihr Warenkorb ist leer
Menü
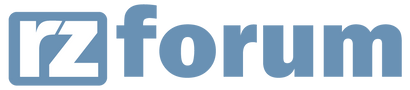
Gerechte Versorgung oder zwei Klassen?
September 02, 2025 7 min lesen.

Foto: mpix-foto/stock.adobe.com
Gesundheitssystem
Die medizinische Betreuung in Deutschland zählt zu den besten weltweit – und doch erleben viele Patientinnen und Patienten eine deutliche Ungleichbehandlung. Was steckt hinter dieser Zweiklassenwahrnehmung im deutschen Gesundheitswesen?
Wer als gesetzlih Versicherter mehrere Wochen auf einen Facharzttermin gewartet hat, während privat versicherte Bekannte diesen bereits nach wenigen Tagen erhielten, kennt das Gefühl: Die medizinische Versorgung hängt nicht nur von der Diagnose, sondern auch vom Versicherungsstatus ab. Diese Praxiserfahrungen sind keine Einzelfälle und mittlerweile auch bei vielen Ärzten, Krankenkassen und politischen Beobachtern bekannt.
Die Hauptursache liegt im System. Die Vergütung für gesetzlich Versicherte ist zu etwa zwei Dritteln pauschaliert: Ärztinnen und Ärzte erhalten eine feste Summe pro Quartal – unabhängig davon, wie oft der Patient kommt oder welche Leistungen erbracht werden. Für Zusatzuntersuchungen wie EKG, Bluttests oder längere Gespräche gibt es meist keine separate Vergütung. Wenn das Budget aufgebraucht ist, wird die Behandlung schnell zum Minusgeschäft. Anders bei Privatpatienten: Jede Leistung wird einzeln abgerechnet, was Planungssicherheit und wirtschaftlichen Spielraum schafft.
Reformversuche wie das von Union und SPD geplante Primärarztsystem, bei dem Hausärzte als erste Anlaufstelle fungieren und die Patienten dann gezielt an Fachärzte überweisen, sollen effizientere Abläufe und Entlastung für überfüllte Facharztpraxen bringen. Viele Anliegen ließen sich dort direkt lösen, Doppeluntersuchungen würden vermieden und so wertvolle Zeit gespart. Doch auch dieses Modell stößt an Grenzen: Vor allem in ländlichen Regionen fehlt es vielerorts an Hausärzten, die den zusätzlichen Zulauf stemmen könnten. Und noch ist unklar, wie die Vergütung im neuen System künftig aussehen soll.
Einig scheinen sich aber alle Beteiligten: das System muss reformiert werden. Die WIRTSCHAFT befragte einige Akteure in Rheinland-Pfalz über ihre Ansicht und ihre Erfahrungen mit dem oft kritisierten Zweiklassen-Gesundheitssystem.
Die Krankenkasse AOK betont die Bedeutung eines gleichberechtigten Zugangs zur ärztlichen Versorgung, unabhängig vom Versicherungsstatus der Patientinnen und Patienten. "Die Menschen brauchen die Gewissheit, dass sie bei der Ärztin/beim Arzt ihres Vertrauens Rat und Hilfe im Krankheitsfall suchen dürfen", sagt Jan Rößler, Pressesprecher der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse. Dabei sei es aus Sicht der AOK kritisch zu bewerten, dass gesetzlich Versicherte bei der Terminvergabe benachteiligt würden. „Die oft beschriebene ‚Zweiklassenmedizin‘ muss vermieden werden – wer echte Gleichbehandlung will, sollte dafür sorgen, dass bei der Terminvergabe nicht mehr danach gefragt werden darf, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist.“ Es müsse ausschließlich um medizinische Notwendigkeit gehen.
Zur Verbesserung der Versorgung befürwortet die AOK ein teamgestütztes Primärversorgungssystem, wie Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, bestätigt: „Fokus unseres Konzepts sind Primärversorgungspraxen als ein gut erreichbarer und verlässlicher Anlaufpunkt für Patientinnen und Patienten.“ Dort sollen Teams aus verschiedenen Gesundheitsberufen eine umfassende Grundversorgung leisten und Patienten gezielt weiterleiten. Eine qualifizierte Überweisung soll dabei die Voraussetzung für den Zugang zur fachärztlichen Versorgung sein – mit Ausnahmen etwa für Kinder- und Jugendarztpraxen, Augen- und Frauenheilkunde sowie für chronisch Kranke. „Es ist uns als AOK grundsätzlich wichtig, dass jegliche Umsetzung von Vorschlägen nicht zu Lasten der Patientinnen und Patienten geht.“
Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) zeigt sich in ihrer Einschätzung zurückhaltender und verweist auf strukturelle Probleme in der ambulanten Betreuung. „Die Ressource niedergelassene Ärztin beziehungsweise Arzt wird aus vielfältigen Gründen immer knapper“, weiß Dr. Andreas Bartels, stellvertretender Vorsitzender. Budgetierung, Bürokratie, Fachkräftemangel und fehlende Studienplätze erschwerten zunehmend die Nachbesetzung von Praxen.
Die KV RLP sieht den Vorschlag des Primärarztmodells kritisch: „Die Regelung in ihrer jetzigen Form würde für eine Praxis binnen eines Jahres durchschnittlich 400 zusätzliche Fälle bedeuten – allein in Rheinland-Pfalz.“ Angesichts bereits überfüllter Wartezimmer und dünner Strukturen im ländlichen Raum sei dies nicht umsetzbar. Die KV warnt: „Das Prinzip kostet nicht nur ärztliche Ressource, sondern auch Geld.“
Zugleich formuliert die KV RLP umfassende Reformforderungen an die Politik. So müsse etwa die Budgetierung vollständig abgeschafft und die Bedarfsplanung reformiert werden. Auch die bürokratischen Hürden im Praxisalltag schreckten viele junge Medizinerinnen und Mediziner von einer Niederlassung ab. „Die aktuellen Rahmenbedingungen sind kein Anreiz, sondern vielmehr Hinderungsgrund, in der vertragsärztlichen Versorgung tätig zu werden“, so Dr. Bartels. Wenn niedergelassene Ärztinnen oder Ärzte ihre Praxis rein privatärztlich weiterführen, geschieht dies meist aufgrund der hohen Bürokratie und den Vorschriften und Regelungen.“ Außerdem seien die in den 1990er-Jahren abgebauten Medizinstudienplätze mitverantwortlich für den heutigen Ärztemangel, besonders in ländlichen Regionen. Laut KV sind in Rheinland-Pfalz derzeit mehr als 223 Hausarztsitze unbesetzt – Tendenz steigend.
Auch der Verband der Ersatzkassen (Vdek), Landesvertretung Rheinland-Pfalz, unterstreicht die Bedeutung der Gleichbehandlung. „Eine systematische Benachteiligung gesetzlich Versicherter wäre mit den Grundsätzen der vertragsärztlichen Versorgung nicht vereinbar“, erklärt Martin Schneider, Leiter des vdek in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig sieht der Verband in einem ausschließlich hausarztzentrierten Modell ebenfalls keine ausreichende Lösung. Vorliegende Auswertungen von Untersuchungen zeigten, dass Patienten weder seltener Fachärzte in Anspruch nehmen noch signifikant weniger stationär behandelt werden. „Eine flächendeckende Einführung dieses Modells als Regelversorgung würde Hausarztpraxen bei derzeit rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten erheblich belasten und neue strukturelle Engpässe in der Versorgung schaffen.“
Dennoch sieht der Verband grundsätzlich mit der Reformierung der Patientensteuerung Chancen und Vorteile und wirbt für die Umsetzung eines neuen Versorgungskonzepts des GKV-Spitzenverbandes und des Vdek-Konzepts ‚Persönliches Ärzteteam‘. Ziel sei eine bessere Patientenbegleitung, kombiniert mit weniger Bürokratie, einem Ausbau telemedizinischer Angebote und mehr Behandlungszeit. Eine gezielte Versorgungssteuerung durch primärärztlich tätige Praxen sei nur hilfreich, sofern sie mit digitaler Infrastruktur und administrativer Unterstützung kombiniert werde. Zur Verbesserung der Versorgung in strukturschwachen Regionen verweist der Vdek auf bestehende Maßnahmen wie Investitionskostenzuschüsse bei Praxisgründungen und -übernahmen.
Eine gänzlich andere Meinung zum Thema Zweiklassenmedizin vertritt Dr. Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. „In Arztpraxen wird bereits heute eine gerechte Versorgung aller Patientinnen und Patienten gewährleistet. Eine Zweiklassenmedizin findet in der Praxis nicht statt, denn die medizinische Betreuung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.“ Es könne höchstens in der Organisation Unterschiede geben, beispielsweise bei Honoraren und individuellen Behandlungsangeboten im PKV-Bereich. „Die Ethik im Gesundheitswesen fordert, dass die Behandlung unabhängig von der Art der Versicherung immer nach dem besten Interesse des Patienten erfolgt.“
Die Landesärztekammer befürwortet das Primärarztsystem und sieht darin eine sinnvolle Steuerung: „Der Hausarzt übernimmt in diesem System eine Art Lotsenfunktion und kann so sicherstellen, dass die Patienten die richtige Versorgung erhalten“, so Dr. Matheis. Durch eine gezielte Überweisung ließen sich Fachärzte entlasten und gleichzeitig Ressourcen im Gesundheitssystem einsparen.
Zudem hebt er den positiven Beitrag der privaten Krankenversicherung (PKV) für das Gesundheitssystem hervor. „Die PKV fördert durch den Wettbewerb im Gesundheitswesen Innovationen und eine hochwertige Versorgung. Höhere Honorare machen die Investitionen in Geräte und Personal möglich, wovon alle Patienten profitieren.“
Insgesamt zeigt sich in den Stellungnahmen der verschiedenen Akteure ein Spannungsfeld zwischen der Forderung nach gerechterer Patientenversorgung und den realen strukturellen Engpässen in der ambulanten Medizin. Während die Krankenkassen eine stärkere Steuerung durch hausärztlich geleitete Primärversorgung fordern, mahnen Ärzteschaft und Kassenärztliche Vereinigung angesichts personeller und finanzieller Engpässe zur Vorsicht. Konsens besteht in der Notwendigkeit, das bestehende System zu reformieren – insbesondere bei der Nachwuchsförderung, Entbudgetierung und Digitalisierung. Ein nachhaltiger und gerechter Wandel wird jedoch nur gelingen können, wenn ökonomische Anreize, medizinische Qualität und soziale Gerechtigkeit in Einklang gebracht werden.
Infokasten:
Bundesbürger verlieren Vertrauen ins Gesundheitssystem
Laut einer aktuellen Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), die im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchgeführt wurde, schwindet das Vertrauen vieler Bundesbürger in das Gesundheitssystem. Jeder zweite Befragte glaubt, dass die Leistungsfähigkeit des Systems abnimmt.
Zwar bezeichnen noch 67 Prozent der Teilnehmenden den gegenwärtigen Zustand der medizinischen Versorgung als zufriedenstellend, doch dieser Wert ist im Vergleich zu vor zwei Jahren deutlich gesunken – damals waren es noch 81 Prozent.
40 Prozent gaben an, in den letzten zwei bis drei Jahren schlechtere Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung gemacht zu haben als zuvor. Nur sieben Prozent berichteten von einer Verbesserung. Damit hat sich das Meinungsbild seit 2019 stark verschlechtert.
Hauptursache sind persönliche Erlebnisse mit Versorgungsengpässen. So haben 77 Prozent entweder selbst oder bei Angehörigen lange Wartezeiten auf Arzttermine erlebt. 54 Prozent waren mit der Nichtverfügbarkeit von Medikamenten konfrontiert und 43 Prozent hatten Schwierigkeiten, überhaupt einen Arzt zu finden, der neue Patienten aufnimmt. Gerade letzteres beeinträchtigt das Vertrauen in das Gesundheitssystem besonders stark, so die Einschätzung der Zeitung.
Für die Befragung wurden im Juli 1003 Personen persönlich interviewt. Bereits im Frühjahr 2023 hatte eine Untersuchung der Bosch-Stiftung ähnliche Resultate geliefert: Damals äußerten fast 60 Prozent der Befragten wenig oder kein Vertrauen mehr in die Fähigkeit der Politik, eine qualitativ gute und gleichzeitig bezahlbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Im Jahr 2020 lag dieser Anteil noch bei 30 Prozent.
Zu den Institutionen:
- Name: Verband der Ersatzkassen e.V. (Vdek) Landesvertretung Rheinland-Pfalz
- Gegründet: 1912 unter dem Namen „Verband kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach. Bis 2009 firmierte er unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V., VdAK
- Geschäftsleitung: Martin Schneider, Leiter der vdek-Landesvertretung Rheinland-Pfalz
- Standort: Mainz
- Kernkompetenz: Der Vdek unterstützt und fördert auf Landesebene die Interessen ihrer Mitgliedskassen.
- Mitarbeitende: 25
- Weitere Informationen: https://www.vdek.com/LVen/RLP.html
- Name: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz
- Gegründet: Am 1. Januar 2005 durch Fusion der regional eigenständigen KVen Rheinhessen, Koblenz, Pfalz und Trier zur landesweiten KV RLP
- Vorstand: Vorstandsvorsitzender San.-Rat Dr. Peter Heinz, stellvertretender Vorsitzender Dr. Andreas Bartels, Mitglied des Vorstands Peter Andreas Staub
- Geschäftsleitung: Geschäftsführer Versorgung Gunther Beth, stellvertretende Geschäftsführerin Dr. Nadja Moreno, Geschäftsführer Finanzen Leo Mattes
- Standort: Hauptsitz Mainz, je ein Regionalzentrum in Koblenz, Neustadt an der Weinstraße und Trier
- Kernkompetenz: Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz. Interessensvertretung und Unterstützung ihrer Mitglieder
- Mitarbeitende: rund 1800 (inklusive ärztlicher Bereitschaftsdienst)
- Weitere Informationen: https://www.kv-rlp.de/
- Name: Landesärztekammer Rheinland-Pfalz
- Gegründet: 1950
- Geschäftsleitung: Präsident Dr. med. Günther Matheis
- Standort: Mainz
- Kernkompetenz: Die Landesärztekammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie vertritt die Interessen von rund 24.500 Mitgliedern. Als Selbstverwaltungsorganisation der Ärzte in Rheinland-Pfalz wahrt sie die ärztlichen Berufsinteressen, fördert die ärztliche Fort- und Weiterbildung, die Qualitätssicherung in der ärztlichen Versorgung und vertritt die ärztlichen Belange gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik.
- Mitarbeitende: 36 hauptamtlich
- Weitere Informationen: https://www.laek-rlp.de
- Name: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse
- Gegründet: 1. März 2012 - durch Fusion von AOK Rheinland-Pfalz und AOK Saarland
- Geschäftsleitung: Vorstandsvorsitzende Dr. Martina Niemeyer
- Standort: Eisenberg / Pfalz
- Kernkompetenz: Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland betreut mehr als 1,2 Millionen Versicherte sowie etwa 100.000 Arbeitgeber und ist der größte Krankenversicherer in der Region Rheinland-Pfalz/Saarland. Rund 30 Kundencenter und mehr als 200 Servicestellen bieten den Versicherten einen wohnortnahen Service rund um das Thema Gesundheit.
- Mitarbeitende: 3300
- Weitere Informationen: https://www.aok.de/pk/rps
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Willkommen? Bürokratie macht Zuwanderung schwer
Oktober 31, 2025 6 min lesen.
Fachkräfte aus dem Ausland könnten den Personalmangel lindern – doch viele Unternehmen verzweifeln an Bürokratie und langen Visaprozessen. Beispiele aus RLP zeigen: Es geht auch anders, aber der Weg bleibt steinig.

Ausgestorben und unattraktiv
Oktober 31, 2025 6 min lesen.
Viele Innenstädte kämpfen mit Leerstand und Tristesse – doch es gibt Wege aus der Krise. Neue Konzepte für Wohnen, Arbeiten, Kultur und Handel zeigen, wie Stadtzentren wieder lebendig werden können – als Orte zum Bleiben, nicht nur zum Kaufen.

Der steinige Weg zum Fördergeld
Oktober 31, 2025 6 min lesen.
Fördergelder sollen Innovationen ermöglichen – doch in der Praxis verlieren viele Betriebe im Antragsdschungel die Orientierung. Zwischen Bürokratie, fehlender Transparenz und Digitalisierungsdefiziten drohen gute Ideen zu scheitern. Wie gelingt Förderung, die wirklich wirkt?

EU AI Act bremst INNOVATIONSKRAFT
Oktober 31, 2025 6 min lesen.
Die Europäische Union hat die weltweit erste umfassende Regulierung für den Einsatz künstlicher Intelligenz auf den Weg gebracht. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Risiken zu begrenzen und Vertrauen in die neue Technologie zu fördern. Doch was aus Sicht der Politik als Schutz- und Ordnungsrahmen gedacht ist, sorgt in der Wirtschaft für wachsende Skepsis.


