Ihr Warenkorb ist leer
Menü
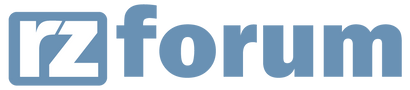
Wasserstoff in der Warteschleife
September 02, 2025 7 min lesen.

Foto SmirkDingo/stock.adobe.com
Zukunft
Der Hype um den Hoffnungsträger der Energiewende ist deutschlandweit abgeflaut. Auch in Rheinland-Pfalz folgten den einstmals ambitionierten Zielen vielerorts Ernüchterung. Ein Blick auf den aktuellen Stand im industriellen Bereich gibt dennoch Zuversicht.
Wasserstoff galt lange als der Gamechanger für Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft. Spätestens mit der „Nationalen Wasserstoffstrategie“ von 2020 wurde das Thema politisch aufgeladen und wirtschaftlich ehrgeizig vorangetrieben. Doch statt Fortschritt und Innovation erleben viele Akteure in Rheinland-Pfalz aktuell vor allem eines: Enttäuschung. Von funktionierenden Strukturen oder gar einem flächendeckenden Einsatz ist man weit entfernt. Stattdessen lähmen technische Probleme, wirtschaftliche Hürden und gekürzte beziehungsweise komplett eingestellte Förderungen auf Bundesebene den angestrebten Hochlauf.
Der Rückzug von zwei kommunalen Projekten aus Rheinland-Pfalz – Smart Quart in Kaisersesch und das Wasserstoffprojekt der Pfalzwerke in Bad Dürkheim – spricht Bände. Die Projekte starteten mit Aussicht auf Millionenförderung, großen Plänen und politischem Rückenwind. Beide missglückten. In Kaisersesch scheiterte das erste Reallabor der Energiewende schlicht am Herzstück – dem Elektrolyseur, der nie zuverlässig funktionierte. In Bad Dürkheim platzte das Projekt, weil sich die Wirtschaftlichkeit nicht darstellen ließ und ein Investor absprang.
Dennoch ist der politische Wille groß, Rheinland-Pfalz zum Vorreiter in der Wasserstoffwirtschaft zu machen. Das Ziel: Klimaneutralität bis spätestens 2040 – und das bei gleichzeitig vollständiger Deckung des Strombedarfs durch erneuerbare Energien bis 2030. Wasserstoff wird dabei als Schlüsseltechnologie gehandelt, insbesondere in energieintensiven Industrien wie Chemie, Glas, Baustoffe oder Logistik.
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) zeigt sich für seine Bereiche Industrie und Nutzfahrzeuge optimistisch: „Rheinland-Pfalz ist beim Thema Wasserstofftechnologie weit fortgeschritten.“ Unternehmen wie BASF in Ludwigshafen und Daimler in Wörth investierten bereits in wasserstoffbasierte Produktion und Transport/Mobilität – unterstützt durch sogenannte IPCEI-Projekte (Important Project of Common European Interest). Dabei handelt es sich um transnationale Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse mit staatlicher Förderung, insbesondere des Bundes aber auch der Länder, die einen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leisten sollen.
Im Bereich der Industrie, dem Transport und der Mobilität bieten sich in Rheinland-Pfalz vor allem im Schwerlast- und Nutzfahrzeugsektor große Anwendungsmöglichkeiten. Mit dem Commercial Vehicle Cluster in Kaiserslautern – mit Unternehmen wie Daimler Truck und einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen und Forschungsinstituten – werden Wasserstoffantriebe für Nutzfahrzeuge wie beispielsweise Lkw weiterentwickelt und erprobt.
Doch was auf Konzernebene funktioniert, bereitet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) große Probleme. „Die ‚Nationale Wasserstoffstrategie‘ ist in ihrer jetzigen Form kaum für KMU geeignet“, heißt es aus der Wirtschaft. „Zu komplex, zu bürokratisch, zu stark auf große Player ausgerichtet.“ Die Folge: zurückhaltende Investitionen, auf Eis gelegte Pläne und Frustration.
Hier setzt die Koordinierungsstelle Wasserstoff Rheinland-Pfalz an. Sie ist bei der Innovationsagentur des Landes angesiedelt und fungiert als Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Forschung – mit einem klaren Fokus auf die Unterstützung mittelständischer Unternehmen. „Unser Ziel ist es, gerade kleinen und kommunalen Akteuren den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zu erleichtern“, erklärt Dr. Stefan Stückrad, Leiter der Koordinierungsstelle. Beratung, Netzwerkbildung und konkrete Projektunterstützung stehen im Mittelpunkt.
„Wasserstoff kann, gut gesteuert und technologieneutral eingesetzt, substantiell zur Zielerreichung bis 2040 beitragen – dabei aber ausschließlich in Sektoren, wo Alternativen nicht ausreichend sind oder technisch-ökonomisch beziehungsweise ökologisch unrentabel wären“. ~ Dr. Stefan Stückrad, Leiter Koordinierungsstelle Wasserstoff RLP
Erfolgreiche Beispiele gibt es bereits. Das Projekt Hy4Chem (IPCEI-Projekt mit BASF) etwa ist laut Stückrad ein Meilenstein: „Es ist vollständig in industrielle Prozesse integriert, läuft bereits im kommerziellen Betrieb und zeigt, dass grüner Wasserstoff in der Industrie nicht nur ein Zukunftsthema ist, sondern heute schon funktioniert.“
Die größten Chancen sieht Stückrad insbesondere in der industriellen Dekarbonisierung, der emissionsarmen Mobilität, der dezentralen Energieversorgung und der Langzeitspeicherung von Energie. „Gerade im industriellen Bereich – etwa in der Chemie-, Baustoff- oder Glasindustrie – kann Wasserstoff fossile Energieträger ersetzen. Damit leisten wir einen direkten Beitrag zur CO₂-Reduktion.“
Doch bis zur flächendeckenden Anwendung ist es ein weiter Weg. Die größten Hürden sind technologischer, infrastruktureller und regulatorischer Natur. Elektrolyseure sind noch teuer und nicht in Serienfertigung verfügbar, die Speicherung von Wasserstoff ist energieintensiv, und bei der Nutzung fehlen marktreife Geräte und Anwendungen. „Insbesondere die Rückverstromung ist noch mit hohen Effizienzverlusten verbunden“, so Stückrad. Kommunale Gasnetze seien oft nicht H₂-tauglich, Wasserstofftankstellen für den Schwerlastverkehr rar. Dazu kommen aktuell lange Genehmigungsverfahren, fehlende Standards und eine fragmentierte Förderlandschaft auf den verschiedenen Ebenen EU, Bund, Länder.
Auch wirtschaftliche Unsicherheiten hemmen den Fortschritt. Die Strompreise in Deutschland machen Elektrolyse unwirtschaftlich, tragfähige Geschäftsmodelle fehlen und viele Bundesprogramme wurden gekürzt oder ausgesetzt. „Wir brauchen dringend stabile Rahmenbedingungen – politisch, finanziell und rechtlich“, fordert Stückrad. „Sonst wird der Markthochlauf immer wieder unterbrochen.“ Aus dem Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz heißt es: „Der Bund hat seine Förderung im Wasserstoffbereich faktisch eingestellt; hier bleibt der neue Haushalt des Bundes abzuwarten, in der Hoffnung, dass hier die komplementären Impulse zu denen der Bundesländer wieder gesetzt werden.“
Ein Hoffnungsträger ist das geplante Wasserstoff-Kernnetz, das bis 2032 bundesweit entstehen soll – mit 9000 Kilometern Länge und 18,9 Milliarden Euro Investitionsvolumen, in das auch Rheinland-Pfalz angebunden wird. In Vorbereitung auf die Zeit nach 2032 erfassen derzeit Akteure wie die Energienetze Mittelrhein bereits den Wasserstoffbedarf in der Region und sprechen gezielt Unternehmen an. Pilotprojekte wie im Industriegebiet Kesselheim in Koblenz testen die Abtrennung von Teilnetzen aus dem Erdgasnetz, um sie künftig wasserstofftauglich zu machen.
Auch Mainz investiert. Zum Bau einer Wasserstoffpipeline mit der Option zur Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz erhielten die Stadtwerke Mainz/Mainzer Netze eine neun Millionen Euro-Förderung vom Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz aus dem KIPKI-Programm.
Mit dem KIPKI-Programm (Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation) fördert das Wirtschaftsministerium mit einem Betrag von 25 Millionen Euro den Hochlauf der Wasserstofftechnologie. Damit werden Wasserstoffnetze wie in Mainz-Mombach mit Millionenbeträgen unterstützt. Ein 2,6 Kilometer langes Verteilnetz, ein Elektrolyseur mit 2,5 MW Leistung und die Option einer Anbindung an Unternehmen wie die Schott AG sollen dort eine lokale Wasserstoffwirtschaft anstoßen. Auch hier steht die spätere Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz im Fokus.
„Wir wollen dem Wasserstoff als neue Technologie mit einer Art Startfinanzierung einen Schub geben, um einen Hochlauf in Gang zu setzen. Dieser muss am Ende wirtschaftlich sein, damit sich entsprechende Anwendungen langfristig am Markt durchsetzen. Großes Potenzial sehen wir dabei insbesondere im Industrie-, Nutzfahrzeug- und Transportbereich.“ ~ Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
Um den Hochlauf zu beschleunigen, setzt Rheinland-Pfalz auf einen technologieoffenen und pragmatischen Ansatz. Das Land setzt daher nicht nur auf grünen Wasserstoff, sondern auch auf sogenannte „blaue“ Varianten, bei denen CO₂ abgeschieden und gespeichert wird. „In der Übergangsphase ist das notwendig“, betont das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium. „Sonst ist die Versorgungssicherheit in der Phase des Hochlaufs nicht gewährleistet.“ Grüner Wasserstoff allein werde auf absehbare Zeit nicht in ausreichenden Mengen verfügbar sein – auch weil Deutschland den Großteil importieren muss.
Das Wirtschaftsministerium formuliert die strategischen Ziele im Bereich Wasserstoff in Rheinland-Pfalz für die nächsten fünf bis zehn Jahre: Ausbau des Wasserstoffkernnetzes, Zulassung verschiedener Wasserstofffarben, Wiederauflage von auf Bundesebene eingestellter Förderprogramme und Ausbau der Unternehmensberatung.
Trotz der noch zu überwindenden Hürden ist Stückrad zuversichtlich: „Rheinland-Pfalz befindet sich beim Thema Wasserstofftechnologie in einer strategisch und technologisch fortgeschrittenen Phase, die sich durch konkrete Leuchtturmprojekte, starke industrielle Akteure, aktive Forschungseinrichtungen und eine ambitionierte Landesstrategie auszeichnet.“ Damit Wasserstoff aber vom Hoffnungsträger zur tragenden Säule der Energiewende werden kann, seien fünf Punkte entscheidend: klare Strategien und Zuständigkeiten, wirtschaftliche Anreize (zum Beispiel Industriestrompreise, CO₂-Bepreisung, Carbon Contracts for Difference), der rasche Ausbau von Infrastruktur, praxisnahe Forschung sowie gesellschaftliche Akzeptanz. Er fasst zusammen: „Ohne kommunale Beteiligung, öffentliche Aufträge und transparente Kommunikation wird es nicht gelingen. Die Technologien entwickeln sich, die Projekte werden konkreter, die Netzwerke dichter. Jetzt braucht es nur noch eines: Verlässlichkeit.“
Infokasten 1: Wasserstoff-„Farben“
Wasserstoff (H) ist ein chemisches Element und neben Sauerstoff (O) ein Bestandteil von Wasser (H2O). Das farblose, flüchtige Gas verbindet sich mit Sauerstoff zu Wasser. Dabei wird Energie freigesetzt, weshalb der Wasserstoff als Energieträger genutzt werden kann. Umgekehrt kann etwa Wasser unter Einsatz von elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden (Elektrolyse). Wenn der dafür eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt (Solar- oder Windkraftanlagen), wird der dabei abgespaltene Wasserstoff als "grüner Wasserstoff" eingeordnet.
"Grün" bezieht sich dabei nur auf den umwelt- und klimafreundlichen Herstellungsprozess, nicht auf die Farbe des Gases. Daneben werden auch noch Türkis, Grau und Blau als Label für Wasserstoff mit einem jeweils nicht so geringen CO2-Fußabdruck verwendet.
Die wichtigsten Farben von Wasserstoff in Abhängigkeit ihrer Treibhausgasemissionen (Stand November 2021
Quelle: Wasserstoffstudie RLP
Infokasten 2: Wasserstoff als strategischer Schlüssel zur Dekarbonisierung

- In der Industrie (Chemie, Prozesswärme) kann H₂ einen großen, messbaren CO₂ Minderungseffekt durch Ersatz fossiler Verfahren leisten
- Im Stromsystem stärkt er die Integration erneuerbarer Energien und die saisonale Speicherkapazität
- Im Verkehr (schwere Nutzfahrzeuge, Busse) bietet er eine wirtschaftliche und technische Alternative zu Batterien
- In Gebäuden sichert er flexibel Wärmeversorgung außerhalb der Elektrifizierung
- Über Infrastrukturentwicklung gewährleistet er Versorgungsketten für Transithandel sowie internationale Vernetzung.
Grafik: Wasserstoffstudie RLP
Infokasten 3: Wasserstoff-Koordinierungsstelle
Seit Ende 2024 bei der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz angesiedelt und vom Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz finanziert, fungiert die Wasserstoff-Koordinierungsstelle als erste Anlaufstelle für Akteure aus der Wirtschaft, Forschung, Gesellschaft und Politik rund um das Zukunftsthema Wasserstoff.
Die Aufgaben:
- Netzwerkaufbau: Ansprache von wichtigen Treibern, Akteuren und Projekten der Technologien und der Wertschöpfung
- Informationsdrehscheibe: Onlineformate und Präsenzveranstaltungen, Akteursübersicht RLP, Matchmaking, themenbezogene Studien, Fact Sheets
- KIPKI Projektinitiative: Ansprechpartner für künftige und laufende Projekte, Impulsgeber für neue Projektvorhaben sowie Außendarstellung und Kommunikation
- Vorausschau zur Technologieentwicklung und Weiterentwicklung der Nutzungsmöglichkeiten von Wasserstoff
- Erstberatung zu Fördermitteln auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
- Unterstützung des Dialogs zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
Weitere Informationen: https://innovationsagentur.rlp.de/was-wir-tun/wasserstoff
Infokasten 4: Innovationsförderung des Landes Rheinland-Pfalz:
Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz können auf Fördermöglichkeiten zugreifen: Landesprogramme wie KIPKI und Investitionshilfen unterstützen konkrete Anwendungen vor Ort, Bundesprogramme flankieren (z. B. Technologieoffensive Wasserstoff, IPCEI) Forschung und Markthochlauf. Ergänzt wird dies durch EU-Fonds wie EFRE und Horizont Europa. Spezielle Programme für KMU (go-Inno, WIPANO) und Beratungsangebote de r Innovationsagentur RLP oder der IHK erleichtern den Zugang.
Weitere Informationen:
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
https://kipki.rlp.de/
https://innovationsagentur.rlp.de/
https://innovationsagentur.rlp.de/was-wir-tun/wasserstoff
Die einzelbetrieblichen Innovationsförderprogramme des Landes unterstützen zielgerichtet innovative, technologieorientierte Unternehmen von der Gründung über die Start-up- und Wachstumsphase bis hin zur Festigung. Die Programme sind technologie- und branchenoffen gestaltet.
Weitere Informationen: https://mwvlw.rlp.de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/innovation/innovationsfoerderung
Gudrun Katharina Heurich
Chefredakteurin
Gudrun Katharina Heurich ist seit 2020 als freie Autorin für die WIRTSCHAFT tätig und übernahm 2023 die Chefredaktion. Die gelernte Redakteurin verantwortet die publizistischen und organisatorischen Redaktionsabläufe und verfasst diverse Artikel zu Wirtschaftsthemen.
Sie möchten mehr zu aktuellen Wirtschaftsthemen erfahren - mit besonderem Bezug auf die Region?
Lesen Sie jetzt die aktuelle WIRTSCHAFT mit dem Code WIR-2802 kostenfrei.

Sichtbar und mutig: weibliche Führungskompetenz
Dezember 19, 2025 5 min lesen.
Sie führen erfolgreich Unternehmen, prägen Wandel und fordern mehr Sichtbarkeit: Drei Unternehmerinnen aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Leistungen im Mittelstand ausgezeichnet – und zeigen, was es heute heißt, mit Haltung zu führen und Veränderung zu gestalten.

Wer setzt der KI Grenzen?
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – schneller als jede Technologie zuvor. Doch was, wenn KI beginnt, selbstständig zu handeln? Der Beitrag zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken wachsen – und warum menschliche Kontrolle entscheidend bleibt.

Arbeiten wo andere Urlaub machen
Dezember 19, 2025 4 min lesen.
Workation ist mehr als ein Trend – sie verändert die Arbeitswelt. Doch was gilt steuerlich, sozialversicherungsrechtlich und organisatorisch? Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen klare Regeln schaffen – und warum die 30-Tage-Grenze entscheidend ist.

2026: Neustart oder erneute Ernüchterung?
Dezember 19, 2025 6 min lesen.
Wirtschaftspolitik im Stresstest: Nach dem Machtwechsel in Berlin wächst in der Wirtschaft die Ernüchterung. Warum viele Unternehmen den Reformwillen vermissen, welche Risiken bestehen – und was es jetzt für einen echten Neustart braucht.



